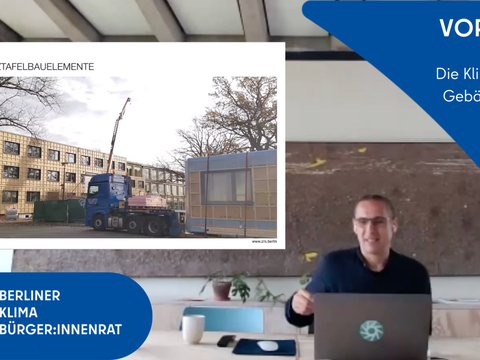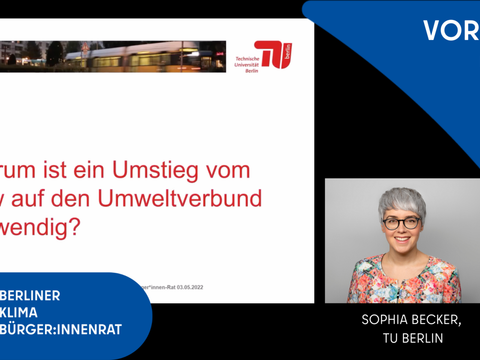„Berliner Klimabürger:innenrat“
Berlin hat sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Um diese zu erreichen wurden Maßnahmen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) 2030 für den Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026 entwickelt. Da die Ausgestaltung solcher Klimaschutzmaßnahmen die gesamte Stadtbevölkerung betreffen wird, wollte der Senat mit Hilfe des „Berliner Klimabürger:innenrates“ in Erfahrung bringen, welche Maßnahmen die Berlinerinnen und Berliner bereit sind für den Klimaschutz mitzutragen und wie die Maßnahmen gerecht und gemeinschaftsfähig ausgestaltet werden können. Den Anstoß zu der Idee hatte eine Volksinitiative gegeben Durchgeführt wurde der „Berliner Klimabürger:innenrat“ von nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH (Berlin), Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (Potsdam) und Klima-Mitbestimmung JETZT e.V. (Köln).

 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache