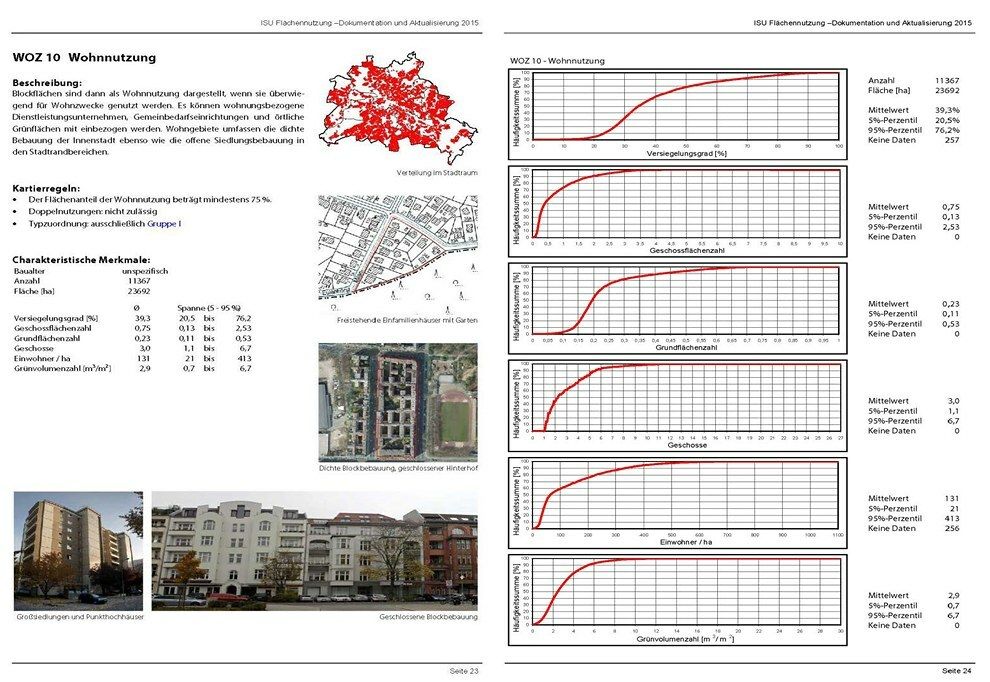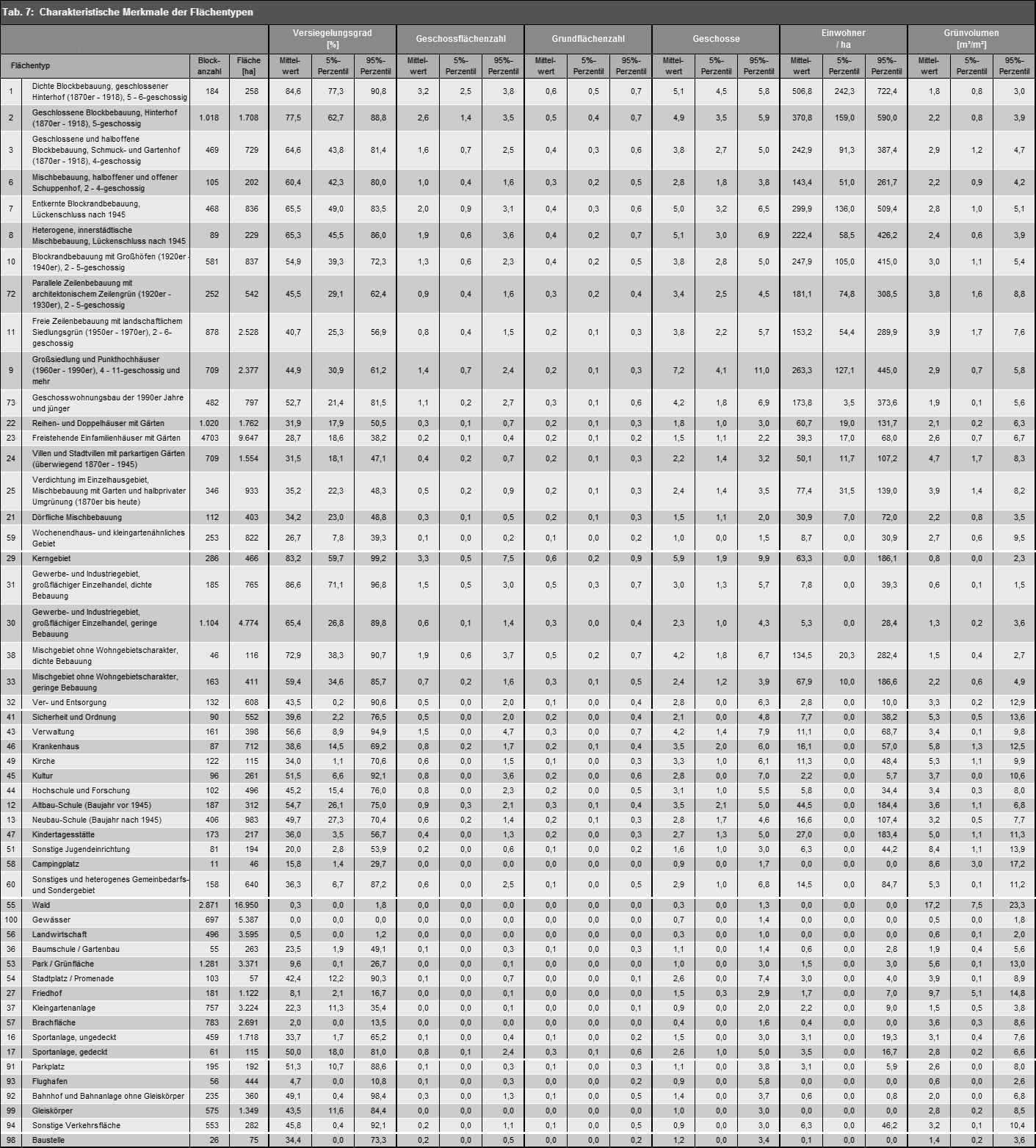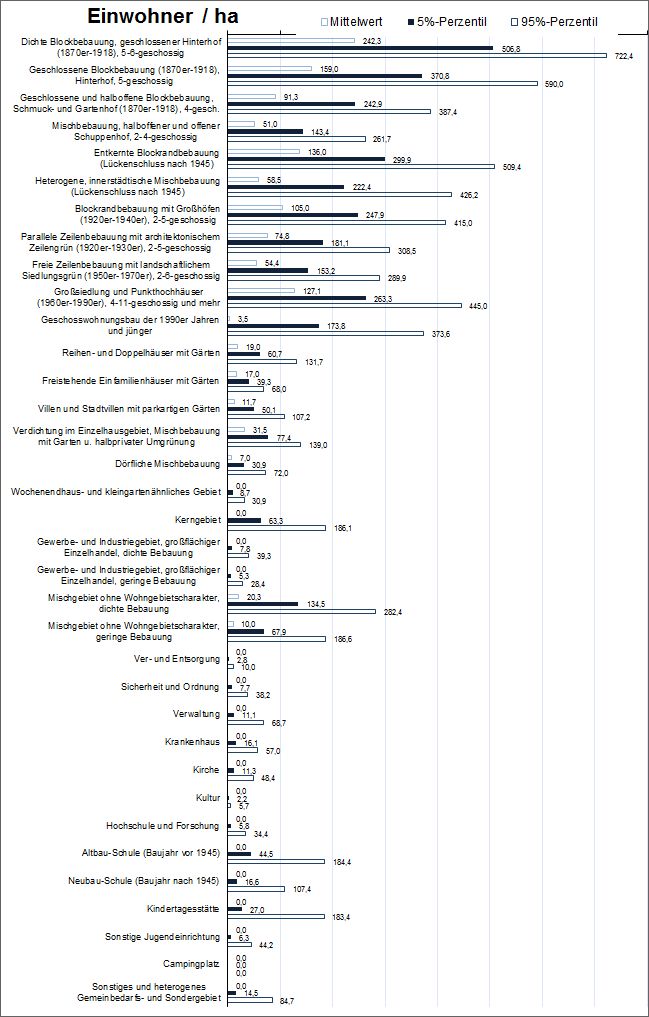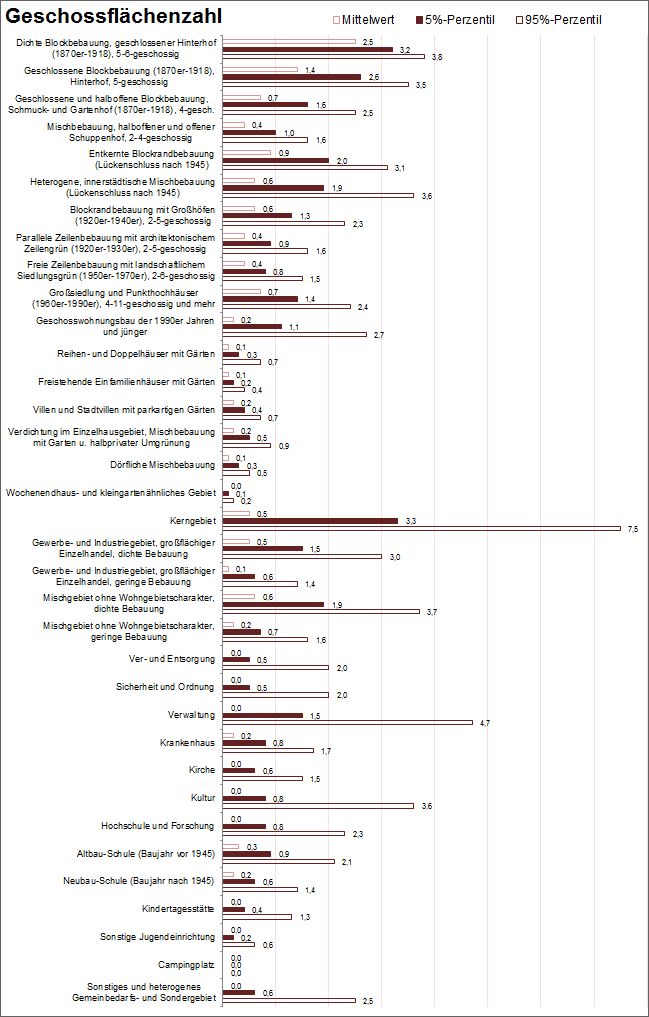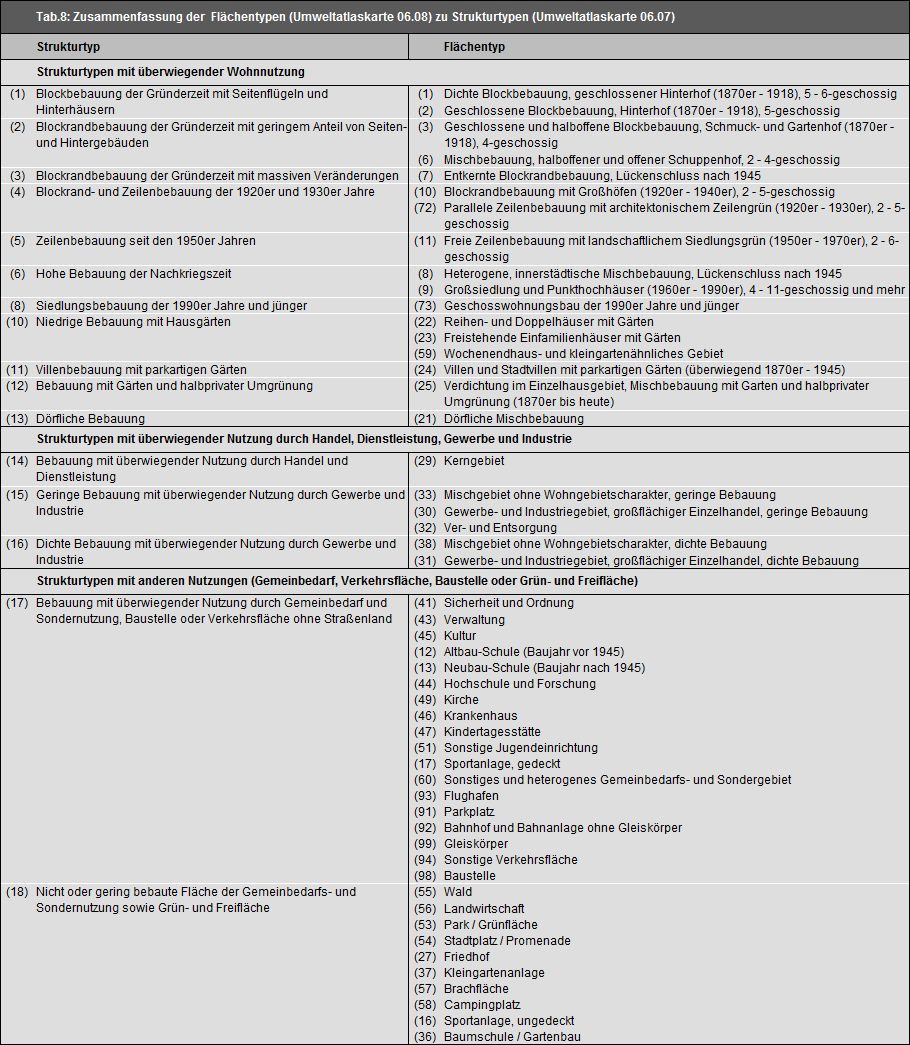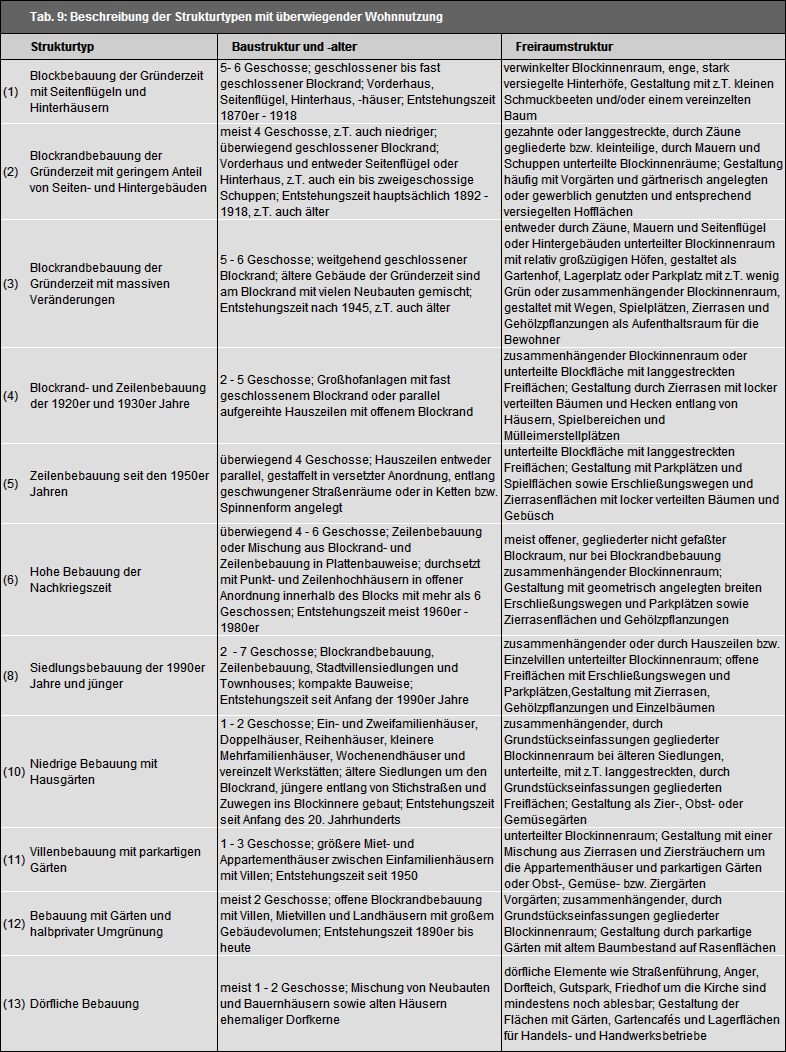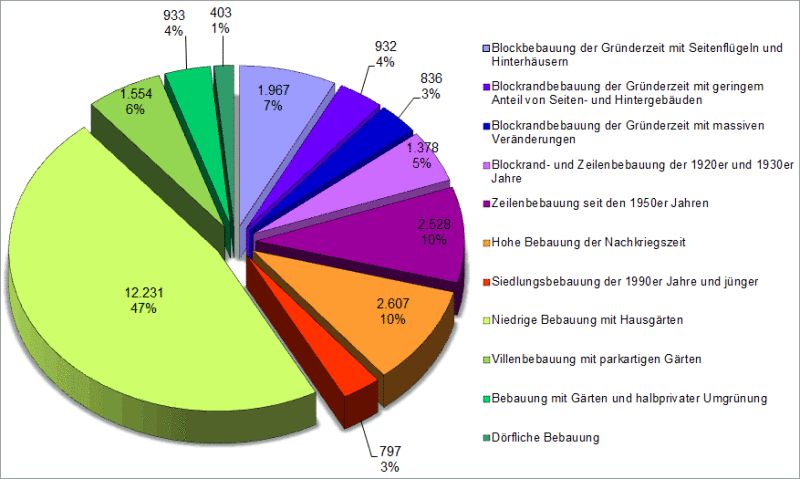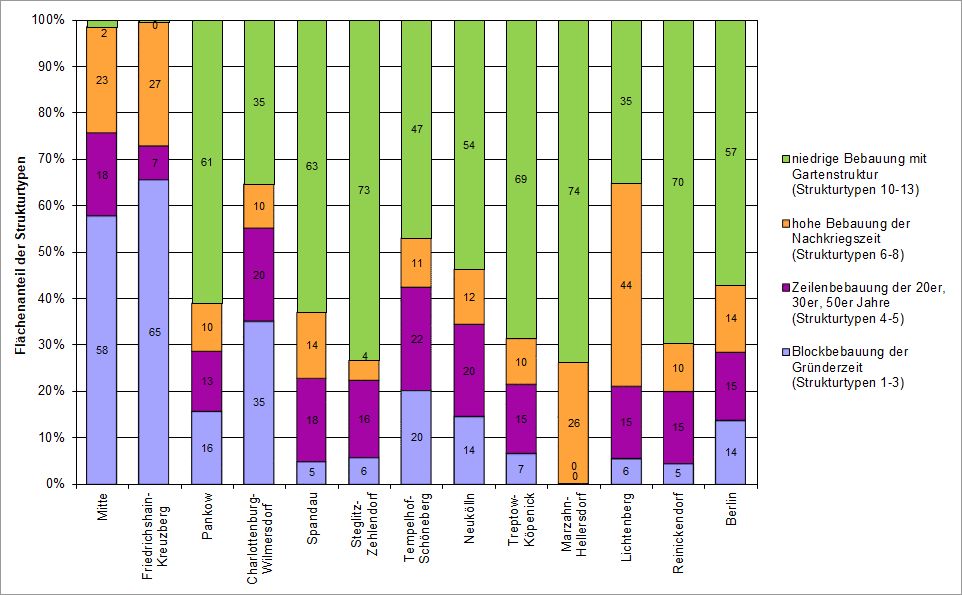Der Flächentyp 1 „Dichte Blockbebauung, geschlossener Hinterhof (1870er-1918), 5-6-geschossig“ entstand in der Gründerzeit (1870 – 1918) zur maximalen Ausnutzung des Bodens für den Wohnungsbau. Er kommt vorrangig innerhalb des S-Bahnringes vor und weist eine geschlossene fünf- bis sechsgeschossige Blockbebauung auf. Zum Teil gibt es noch mehrere Hinterhöfe. Sie sind in der Regel allseitig von Gebäuden umgeben, untereinander nur durch Durchfahrten verbunden und zum Teil auf Lichtschachtgröße reduziert. Die Hinterhöfe werden teilweise gewerblich genutzt. Meist dienen sie aber nur als Zugänge zu Seiten- und Hinterhäusern und als Stellplatz für die Abfallentsorgung oder für Fahrräder. Die Höfe sind nicht nur bei gewerblicher Nutzung nahezu vollständig versiegelt. Dieser Flächentyp ist somit der am dichtesten bebaute und versiegelte Wohnbereich.
Mit dem Flächentyp 2 „Geschlossene Blockbebauung, Hinterhof (1870er-1918), 5-geschossig“ werden Blöcke mit überwiegend geschlossener, fünfgeschossiger Blockbebauung bezeichnet, die zwischen 1870 und 1918 vorrangig innerhalb des S-Bahnringes für die schnell wachsende Berliner Bevölkerung entstanden. Die Blöcke bestehen zum überwiegenden Teil aus Altbauten mit Seiten- und/oder Querflügeln. Dazu kommen Gewerbe- und Fabrikgebäude, Gemeinbedarfsbauten sowie erneuerte und neue Gebäude im Blockrand. Die Höfe sind mehr-, aber nur selten allseitig von hohen Gebäuden umschlossen. Von benachbarten Höfen werden sie oft durch Mauern oder Zäune getrennt, so dass sie sich zu verwinkelten Blockinnenräumen zusammenfügen. Teilweise wurden im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen Hofflächen durch sparsame Abrisse miteinander vereint und werden nun als zusammenhängende Aufenthaltsfläche für gemeinschaftliche Einrichtungen wie z.B. Kindertagesstätten genutzt.
Der Flächentyp ist durch eine starke Durchmischung der Wohnsubstanz mit Arbeitsstätten gekennzeichnet. Auch größere Gewerbebetriebe, die auf eine größere unbebaute Fläche für Lagerzwecke, Anlieferung, Parken etc. angewiesen sind, sind in diesem Flächentyp zu finden.
Diese Kategorie weist im Vergleich zum Flächentyp „Dichte Blockbebauung“ einen etwas geringeren Bebauungs- und Versiegelungsgrad auf. In guten Wohngegenden sind die Höfe öfter mit alten Bäumen, gepflasterten Wegen und Schmuckbeeten ausgestattet. In Wohngegenden mit einem geringeren Sanierungsanteil ist der Anteil der vollständig versiegelten und spärlich begrünten Höfe höher.
Der Flächentyp 3 „Geschlossene und halb offene Blockbebauung, Schmuck- und Gartenhof (1870er-1918), 4-geschossig“ ist durch eine viergeschossige Blockbebauung gekennzeichnet; oftmals sind Vorgärten vorhanden. Die Blöcke mit Schmuck und Gartenhöfen sind während der Gründerzeit (1870er – 1918) in den damaligen Vororten Berlins außerhalb des S-Bahnringes (heutiger Innenstadtrand) entstanden. Die Gebäude haben nur Seiten- oder nur Quergebäude, aber in der Regel nicht beides. Charakteristisch ist ein – im Vergleich zu den beiden vorher beschriebenen Flächentypen gut belichteter Blockinnenraum, der überwiegend gärtnerisch gestaltet ist.
Der Flächentyp 6 „Mischbebauung, halboffener und offener Schuppenhof, 2-4-geschossig“ zeichnet sich durch eine offene Mischbebauung aus, die insbesondere in Innenstadtrand- und Stadtrandlagen zu finden ist und dort vor allem an die alten Ortskerne und Subzentren gebunden ist. Es finden sich Reste alter Bebauung, die schon vor 1870 entstanden – zum Teil niedrige alte Häuser, Schuppen und Werkstätten in den Höfen – und die mit der viergeschossigen Bebauung des Typs „Schmuck- und Gartenhof“ sowie mit Neubauten (sowohl Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbau) aus der Zeit nach 1945 durchsetzt sind. Das Bild dieser Gebiete ist dementsprechend recht heterogen. Kennzeichnend ist der kleinteilig gegliederte Blockinnenraum, häufig mit gewerblich genutzten Werkstätten, Lager- und Abstellplätzen; es gibt aber auch vereinzelt privat genutzte Gemüse- und Obstgärten.
Der Flächentyp 10 „Blockrandbebauung mit Großhöfen (1920er-1940er), 2-5-geschossig“ bezeichnet eine Art der Blockrandbebauung mit großen Wohninnenhöfen, wie sie in den späten 1920er bis Mitte der 1940er Jahre typisch war.
Die großen Höfe werden durch eine geschlossene oder fast geschlossene zwei- bis fünfgeschossige, an den Straßenfluchten orientierte Bebauung gebildet. Sie sind durch mehr oder weniger repräsentativ ausgestattete Eingangsbereiche und manchmal halböffentliche Passagen mit dem Straßenraum verknüpft. Die großflächigen Höfe sind fast vollständig begrünt und durch eine architektonisch-symmetrische Gestaltung geprägt. In einigen frühen Siedlungen wurde der Hof durch heckengefasste Mietergärten genutzt. Ansonsten überwiegt eine Freiraumgestaltung mit Rasenflächen, auf denen verteilt alte Bäume stehen. Besonders charakteristisch sind Arten mit lockerem Habitus (Birke, Weide), die mit symmetrisch angeordneten Bäumen mit architektonischen Formen (Pyramiden-Pappeln, Fichten) kontrastieren. Erschließungswege sind in der Regel sparsam dimensioniert, teilweise wurden jedoch nachträglich Stellplätze und Garagen eingebracht.
Der Flächentyp 72 „Parallele Zeilenbebauung mit architektonischem Zeilengrün (1920er-1930er), 2-5-geschossig“ beschreibt die Zeilenbebauung der 1920er und 1930er Jahre. Ende der 1920er Jahre und in den 1930er Jahren wurden in Berlin die ersten Häuser in Zeilenform gebaut. Ihr Hauptzweck war bei optimaler Ausnutzung der Grundstücke, in allen Wohnungen viel Licht, Luft und Sonne zu schaffen. Die langgestreckten, zwei- bis fünfgeschossigen Hauszeilen sind parallel zueinander aufgereiht. Der Freiraum zwischen den Häusern ist schmal und langgestreckt und an den kurzen Seiten offen.
Die Zeilenbauten geben der Straße eine räumliche Fassung, indem sie nicht locker auf der Fläche verstreut stehen (wie in den Jahren nach 1950 üblich), sondern gleichmäßig rechtwinklig zur Straße stehen, so dass die Schmalseiten die Straßenflucht bilden. Teilweise werden auch abschließende Quergebäude parallel zur Straße angeordnet, so dass eine Mischung aus Zeilen- und Randbebauung entsteht und abwechslungsreiche Außenräume gestaltet werden. Zur optischen Auflockerung werden Durchgänge, Einblicke oder Hausvorsprünge eingesetzt. Außerdem wird der Straßenraum durch leicht vor- und zurück versetzte Gebäude und platzartige Erweiterungen variiert. Vorgärten sind fast immer vorhanden.
Der Flächentyp 8 „Heterogene, innerstädtische Mischbebauung, Lückenschluss nach 1945“ liegt ebenfalls innerhalb der gründerzeitlichen Wohnquartiere. Im Unterschied zum vorangehenden Flächentyp wurden hier teilweise hohe Miet- und Bürogebäude als Zeilen- oder Punkthäuser auf die Blockfläche gebaut, häufig ohne dass die historische Bauflucht oder die Bauhöhen berücksichtigt wurden. Reste gründerzeitlicher Bebauung sind nur noch vereinzelt anzutreffen. Die Blöcke besitzen weder einen Blockinnenraum noch abgeschlossene halbprivate Hofräume. Die räumlich nicht gefassten Freiflächen dienen als Pkw-Stellplätze in Form von Tiefgaragen und Parkplätzen. Die verbleibenden Freiflächen sind überwiegend als nicht nutzbare Abstandsgrünflächen gestaltet.
Der Flächentyp 7 „Entkernte Blockrandbebauung, Lückenschluss nach 1945“ liegt verstreut innerhalb der gründerzeitlichen Wohnquartiere in Innenstadt- und Innenstadtrandlage. Die alte, im 2. Weltkrieg zerstörte Bausubstanz wurde durch Wiederaufbau der Altbauten oder Neubebauung der Lücken ersetzt. Die Neubauten wurden in der Regel der alten Bauflucht angepasst, so dass dieser Flächentyp durch einen weitgehend geschlossenen Blockrand charakterisiert ist, der allerdings durch Einfahrten, Parkplätze, Baulücken etc. teilweise unterbrochen ist.
Im Rahmen der Modernisierung oder dem Neubau der Vorderhäuser wurden oft sämtliche Quergebäude, Hinterhäuser und Schuppen abgerissen. So entstand gegenüber der ursprünglichen Bebauung ein offenerer Blockinnenraum, der meist an den einzelnen Grundstücksgrenzen mit Zäunen unterteilt ist. Neben den alten Hofgestaltungen dominieren dann häufig Parkplätze mit Umgrünung durch Rasen und Sträucher. Teilweise entstanden aber auch relativ große Innenräume, die als Aufenthaltsraum für die Bewohner mit Grün- und Rasenflächen, Spielplätzen und Bänken gestaltet oder in die Gemeinbedarfseinrichtungen wie Kindertagesstätten gelegt wurden.
Der Flächentyp 73 „Geschosswohnungsbau der 1990er Jahre und jünger“ umfasst die seit Anfang der 1990er Jahre entstandenen Baugebiete, die sich erheblich von den typischen Großsiedlungen (vgl. Typ 9 „Großsiedlung und Punkthochhäuser“ (1960er-1990er)) unterscheiden und eine weite Spanne von städtebaulichen Strukturen (z.B. Blockrandbebauung, Zeilenbebauung, Stadtvillen und Townhouses) umfassen. Es handelt es sich im Wesentlichen um größere Wohnungsbauvorhaben der 1990er Jahre und der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts, die zum Teil im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen realisiert wurden (Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Rummelsburger Bucht) sowie weiterer Großprojekte (Karow-Nord, Buchholz etc.). Einfamilienhausgebiete sowie Reihen- und Doppelhaussiedlungen, die erst in den 1990er Jahren oder später entstanden, werden dagegen den entsprechenden Flächentypen mit unspezifischem Baualter zugeordnet (Flächentypen 22: “Reihen- und
Doppelhäuser mit Gärten” und 23: „Freistehende Einfamilienhäuser mit Gärten“).
Freiflächen und Innenhofbereiche der seit den 1990er Jahren entstandenen Siedlungen werden häufig als halböffentliche Grünflächen mit Spielplätzen und Aufenthaltsbereichen gestaltet, den Parterre-Wohnungen sind oft Terrassen- oder kleine Gartenbereiche zugeordnet. Stellplätze werden vermehrt in Tiefgaragen untergebracht.
Die seit den 1990er Jahren entstandenen Siedlungen weisen zudem aufgrund der aktuellen Standards eine vergleichsweise energiesparende, teilweise ökologisch orientierte Bauweise auf (relativ gute Dämmung, teilweise Passivhäuser, Regenwasserversickerung, Dachbegrünung etc.).
Die Bebauung des Flächentyps 9 „Großsiedlung und Punkthochhäuser (1960er-1990er), 4-11-geschossig und mehr“ entstand zwischen den späten 1960er Jahren bis Ende der 1990er Jahre. Es handelt sich oft um zusammenhängende Großsiedlungen im Stadtrandbereich (Satellitenstädte), die überwiegend in Plattenbauweise errichtet worden sind. Kleinere Siedlungen mit Zeilen oder Blockbebauungen finden sich in den Subzentren und im Innenstadtbereich. Im Ostteil der Stadt wurde die Plattenbauweise punktuell auch innerhalb historischer Strukturen eingesetzt.
Typischerweise werden hier, anders als beim nachfolgenden Flächentyp 11 der „Freien Zeilenbebauung der 1950er bis 1970er Jahre“, verschiedene Gebäudehöhen und -formen innerhalb einer Siedlung verwendet. Oft handelt es sich um eine vier- bis achtgeschossige, halboffene Blockrandbebauung oder eine Mischung von Blockrand- und Zeilenbebauung, die z.T. mit mehr als zehngeschossigen Punkthochhäusern oder Hochhausketten kombiniert wird. Insbesondere in den Großsiedlungen haben die Gebäude in ihrer Stellung häufig keinen Bezug zur Straße, so dass eine homogene Straßenraumbildung fehlt.
Zwischen den Gebäuden liegen große, räumlich oft nicht gefasste Freiflächen, die durch eine hohe Anzahl ebenerdiger Stellplätze geprägt werden. Auf den unversiegelten Flächen dominieren Zierrasen und Gehölzpflanzungen.
Der Flächentyp 11 „Freie Zeilenbebauung mit landschaftlichem Siedlungsgrün (1950er-1970er), 2-6-geschossig“ entstand in der Nachkriegszeit hauptsächlich in den 1950er bis 1970er Jahren im Rahmen der Wiederaufbauprogramme. Die langgestreckten, in Zeilen angeordneten, hauptsächlich viergeschossigen Hausblöcke wurden meist in Form zusammenhängender Siedlungen in vom Krieg stark zerstörten ehemaligen Wohnbereichen der Innenstadt sowie in den Randbereichen der kompakten Bebauung am Innenstadtrand errichtet.
Die Bebauung orientiert sich, im Gegensatz zu der Zeilenbebauung der 1920er und 1930er Jahre, nicht mehr direkt am vorgegebenen Straßenraster. Sie steht vielfach in Ost-West-Richtung, um die Besonnung der Wohnungen zu gewährleisten, ist aber nicht mehr so streng parallel angeordnet wie die in den 1920er und 1930er Jahren errichteten Zeilen. In den späteren Jahren baute man die Zeilen häufig gestaffelt in versetzter Anordnung oder reihte sie beliebig um ein geschwungenes Straßennetz an. In den 1970er Jahren baute man auch in Ketten- oder Spinnenform. In Gegensatz zum Flächentyp „Großsiedlung und Punkthochhäuser“ sind dabei in den einzelnen Siedlungen in der Regel einheitliche Bauformen und -höhen vorzufinden.

 Leichte Sprache
Leichte Sprache