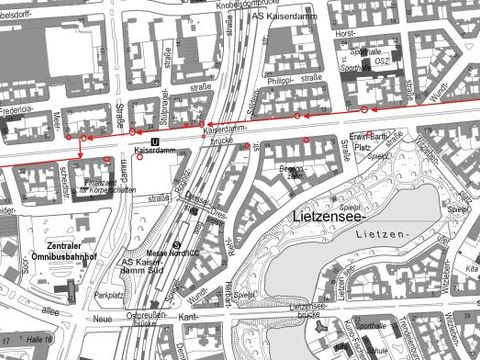Kaiserdamm 16: Armin T. Wegner
Am 17.5.2002, an seinem 24. Todestag, wurde unter großer Anteilnahme der armenischen Gemeinde diese Gedenktafel für Armin T. Wegner enthüllt. Sie musste auf dem Gehweg angebracht werden, weil die Hausbesitzer nicht damit einverstanden waren, die Tafel an ihrem Haus anzubringen.
Der Text lautet:
“Hier, im Hause Kaiserdamm 16,
lebte von 1925 bis zu seiner Verhaftung am 16. August 1933
der Schriftsteller, Lyriker und Journalist
Armin T. Wegner
16.10.1886 – 17.5.1978
Als Augenzeuge berichtete er über den Völkermord
an den Armeniern im 1. Weltkrieg.
In einem Brief an Hitler protestierte er schon im April 1933
gegen die Verfolgung der Juden.
Als Pazifist denunziert, verschleppten ihn die Nationalsozialisten in die Konzentrationslager Oranienburg, Börgermoor und Lichtenburg.
Seine Bücher wurden verbrannt, sein Werk verschwiegen.
In Armenien wie in Israel zählt er zu den
GERECHTEN DER VÖLKER”
Als Jürgen Serke im Jahr 1976 bei Recherchen für sein Buch “Die verbrannten Dichter” den 90jährigen Schriftsteller Armin Theophil Wegner in Rom besuchte, um ihn zu interviewen, da reagierte dieser mit den Worten: “Ich war der einsamste Mensch. Ich habe noch so viel zu sagen. Warum seid ihr denn nicht früher gekommen?”
Armin T. Wegner ist fast vergessen. Kaum eines seiner Bücher ist im Buchhandel erhältlich. Er ist einer der vielen Deutschen, denen Hitler ihre Heimat genommen hat. Viele von ihnen waren auch nach 1945 nicht in ihrer alten Heimat willkommen. Armin T. Wegner wurde sogar zeitweise für tot gehalten.
Er ist nicht nur ein wichtiger Autor, sondern auch ein großes Vorbild, ein Verfechter der Menschenrechte und ein mutiger Demokrat, der unmittelbar nach Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 Zivilcourage bewiesen hat, wie kaum ein anderer. Das ist im Ausland bekannter als bei uns.
In Israel und in Armenien zählt er nicht von ungefähr zu den “Gerechten der Völker”.
Der 1886 in Elberfeld geborene Armin Theophil Wegner wurde im Ersten Weltkrieg Augenzeuge des Völkermords an den Armeniern. Er berichtete über diesen Völkermord und schuf darüber seine beeindruckendsten literarischen Werke, besonders “Weg ohne Heimkehr” und “Der Knabe Hüssein”. Seit 1925 lebte er hier in dem Haus am Kaiserdamm 16, und hier schrieb er auch seinen wohl bemerkenswertesten und mutigsten Text: Am Ostermontag, dem 11. April 1933, schrieb Armin T. Wegner einen Brief an Adolf Hitler, in dem er ihn aufforderte, die antisemitischen Maßnahmen in Deutschland einzustellen:
“Ich wende mich an Sie als ein Deutscher, dem die Gabe der Rede nicht geschenkt wurde, um sich durch Schweigen zum Mitschuldigen zu machen.”
Wenn wir diesen Brief heute lesen, dann wissen wir nicht, was wir mehr bewundern sollen, den Mut des Autors, seine klare, unmissverständliche Sprache, seine Menschlichkeit und moralische Integrität, seine Parteinahme für die verfolgten jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die Selbstverständlichkeit, mit der er die Menschenrechte in Deutschland einfordert oder die Naivität, mit der er glaubt, den Diktator mit Argumenten überzeugen zu können. Er schreibt: “Gerechtigkeit war stets eine Zierde der Völker, und wenn Deutschland groß in der Welt wurde, so haben auch die Juden daran mitgewirkt…
Wir haben das Blutopfer zwölftausend jüdischer Männer im Kriege angenommen, dürfen wir mit einem Rest von Billigkeit im Herzen ihren Eltern, Söhnen, Brüdern, Enkeln, ihren Frauen und Schwestern verwehren, was sie sich durch viele Geschlechter erworben haben, das Recht auf Heimat und Herd?”
Der Brief an Hitler endet mit den Worten: “Ich beschwöre Sie! Wahren Sie den Edelmut, den Stolz, das Gewissen, ohne die wir nicht leben können, wahren Sie die Würde des deutschen Volkes!”
Wir wissen, dass Wegners Brief keinen Erfolg hatte. Wir wissen, dass die Nationalsozialisten sich um das Gewissen und die Würde der Deutschen nicht scherten. Wir wissen, dass sie gegen jede Moral und Menschlichkeit handelten. Umso mehr beeindruckt uns heute der Brief von Armin T. Wegner. Die Antwort der Nationalsozialisten war brutal: Wegner wurde verhaftet und in Konzentrationslagern misshandelt, bevor er 1934 nach England fliehen konnte. Anschließend emigrierte er nach Italien und lebte bis zu seinem Tod am 17.Mai 1978 in Rom.
Das Gottfried-Keller-Gymnasium hat eine Patenschaft für diese Gedenktafel übernommen, das heißt eine Klasse sorgt regelmäßig für den guten Zustand der Tafel und setzt zum Beispiel am Geburts- und Todestag Wegners besondere Zeichen der Erinnerung.
Dies ist ein guter Anlass, sich mit unserer Geschichte auseinander zu setzen, und, wie die Schule betont, gerade für die große Gruppe türkischer Schülerinnen und Schüler, auch mit der türkisch-armenischen Geschichte.
Kaiserdamm 102: Ferdinand Bruckner
Schräg gegenüber, am Haus Kaiserdamm 102, wurde 1987 eine Berliner Gedenktafel, also eine Porzellantafel der KPM, für Ferdinand Bruckner enthüllt.
“Wohnhaus von
FERDINAND BRUCKNER
-Theodor Tagger-
26.8.1891 – 5.12.1958
Dramatiker, Lyriker, Gründer
und erster Direktor
des Renaissance-Theaters”
Kaiserdamm 19: Stolpersteine
Vor dem Haus Kaiserdamm 19 erinnern zwei Stolpersteine an Frida Holz und Rose Seligmann. Sie wurden mit dem ersten Ost-Transport aus Berlin am 18.10.1941 über das Sammellager in der Synagoge Levetzowstr. 7-8 und den Bahnhof Grunewald nach Litzmannstadt und von da am 8. Mai 1942 nach Kulmhof (Chelmno) deportiert und dort ermordet.
Kaiserdamm 97: August Horch
Fünf Häuser weiter, am Kaiserdamm 97, widmete die Firma Audi ihrem Gründer August Horch eine Berliner Gedenktafel, die im Jahr 2000 an dem von der Charlottenburger Baugenossenschaft 1994 errichteten Haus der Nationen angebracht wurde. Das frühere Wohnhaus von August Horch wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der Text lautet:
“Hier wohnte von 1934 bis 1943
AUGUST HORCH
12.10.1868-3.2.1951
Automobilkonstrukteur
und Pionier des Kraftfahrzeugs
Begründer der Automobilmarken
“Horch” und “Audi””
Kaiserdammbrücke
Wir überqueren jetzt gleich die Autobahn und Ringbahn. Die Kaiserdammbrücke wurde 1906 errichtet. Sie überquert die Autobahn A 100, die Gleise der S-Bahn und der Fernbahn. Sie besteht aus Stahl, ist 87 m lang, 50 m breit, hat eine Fläche von 4.400 qm und ruht auf drei Reihen stählernen Säulen. Auf jeder Seite hat sie fünf Fahrspuren, einen Radweg und einen breiten Bürgersteig. Auch diese Brücke wurde 1967 für kurze Zeit in Adenauerdammbrücke umbenannt, was aber bereits nach wenigen Monaten wieder rückgängig gemacht wurde.
Mittelstreifen: Mahnmal für Giuseppe Marcone
Am 14. Juni 2013 hat die Giuseppe Marcone Stiftung hier auf dem Mittelstreifen des Kaiserdamms diesen Baum gepflanzt und eine kleine Gedenktafel enthüllt.
Aus dem U-Bahnhof Kaiserdamm heraus wurde Giuseppe Marcone hier am 17. September 2011 zu Tode gehetzt, als er auf der Flucht vor Schlägern aus dem U-Bahnhof Kaiserdamm rannte und ihn ein Auto auf der Straße überfuhr. Die Inschrift lautet:
“‘Ein Engel kam, lächelte und kehrte um.’
An dieser Stelle wurde Giuseppe Marcone
am 17. September 2011 im Alter von 23 Jahren durch gewalttätige Jugendliche in den Tod gehetzt.
Möge sein Schicksal den Menschen Mahnung sein, einander mit Achtung und Respekt zu begegnen.”
Die Giuseppe Marcone Stiftung für gegenseitige Achtung und Zivilcourage wurde von der Mutter Vaja und dem Bruder Velin Marcone gegründet, um die Erinnerung an ihren Sohn und Bruder wach zu halten und um sich gegen Gewalt in unserer Gesellschaft zu engagieren. Sie hat bereits ein Kunst-Licht-Projekt am Alexanderplatz zur Erinnerung an jugendliche Opfer von Gewalt im öffentlichen Raum und im Februar dieses Jahres eine Lichtergalerie gegen Gewalt im Lietzenseepark installiert. Die Familie Marcone lässt uns daran teilnehmen, wie sie aus ihrer Trauer hoffnungsvolle Aktionen entwickelt – ganz im Sinne des verstorbenen Giuseppe Marcone. Aus seinem Tod wird so eine optimistische Mahnung zur Verständigung, zu gegenseitiger Achtung und Zivilcourage.
Kaiserdamm 22: Drei Stolpersteine
Vor dem Haus Kaiserdamm 22 erinnern drei Stolpersteine an Hedwig und Edith Broh und an Cato Bontjes van Beek.
Als Hitler 1933 an die Macht kam, war Cato Bontjes van Beek zwölf Jahre alt. Sie hatte gerade einen zweijährigen Aufenthalt bei ihrer Tante in Amsterdam hinter sich, sprach fließend Niederländisch und freute sich, endlich wieder in Fischerhude zu sein. Die Mutter Olga Bontjes van Beek, Ausdruckstänzerin und Malerin, machte sich über Hitler lustig. Bei den Besuchern, die zuhause ein- und ausgingen, handelte es sich ebenfalls durchweg um Gegner des Nationalsozialismus. Sie waren Literaten, Künstler und Philosophen wie Theodor Lessing, der mit den Kindern die Moor- und Heidelandschaft erkundete. Jeder in Fischerhude wusste: Die Bontjes stehen links. Jan, der Vater, dessen Eltern aus den Niederlanden stammten, war als „roter Matrose“ ins Dorf gekommen. Man ließ ihn und die anderen gewähren.
Die 1930er Jahre verliefen für Cato weitgehend ohne Konflikte. Daran änderte auch die Scheidung der Eltern kaum etwas. Jan Bontjes van Beek zog nach Berlin, gründete dort eine Keramikwerkstatt und heiratete zum zweiten Mal, und zwar eine Innenarchitektin mit jüdischen Vorfahren.
Ende 1937 besuchte Cato eine kaufmännische Fachschule in Berlin und absolvierte eine Lehre als Keramikerin in der Werkstatt ihres Vaters. In dessen Wohnung lernte sie im September 1940 Libertas Schulze-Boysen kennen, die Frau von Harro Schulze-Boysen, der neben Arvid Harnack der Kopf der von der Gestapo so genannten Roten Kapelle war. Durch sie geriet Cato sofort ins Zentrum der Widerstandsgruppe und erfuhr von den Gräueltaten, die an der Ostfront an Polen, Russen und Ukrainern verübt wurden. Zusammen mit ihrem Freund Heinz Strelow stellte sie sich gegen das verbrecherische NS-Regime. Cato wirkte an der Herstellung und Verteilung von Flugblättern mit und versteckte Verfolgte. Sie half französischen Kriegsgefangenen und ukrainischen Zwangsarbeiterinnen. Ein von der deutschen Abwehr abgefangener und entschlüsselter Funkspruch aus Moskau, der die Klarnamen der führenden Köpfe der Berliner Roten Kapelle nannte, wurde der Gruppe zum Verhängnis. Die Zerschlagung einer der
größten Widerstandsgruppen mit dem zugleich höchsten Anteil an Frauen begann im Herbst 1942. Die Gestapo verhaftete etwa 130 Anhänger, darunter Cato Bontjes van Beek. Im Januar 1943 verurteilte das Reichskriegsgericht sie und weitere Mitglieder der Gruppe, darunter ihren Freund Strelow, zum Tode. Fast zehn Monate verbrachte die junge Frau in Berliner Gefängnissen, bevor sie am 5. August 1943 in Plötzensee hingerichtet wurde. Sie war 22 Jahre alt.
Kaiserdamm 25: Wohnhaus von Hans Scharoun
Dieses Wohnhaus am Kaiserdamm 25 wurde 1928/29 von Hans Scharoun und Georg Jacobowitz für die “Aktiengesellschaft West für Textilhandel” gebaut. Es steht unter Denkmalschutz. Der weiße sechsgeschossige Putzbau im Stil der Neuen Sachlichkeit enthält Ein- bis Zwei-Zimmer-Appartements für Alleinstehende.
Wie man sieht gibt es das Zeitalter der Singles schon etwas länger. Gelobt wurden damals die optimale Wohnflächenanordnung und die aufwendige Ausstattung.
Im Erdgeschoss befindet sich eine Ladenzone, im Dachgeschoss Ateliers und Dachgärten. Ein geplanter Gaststättenservice für die Bewohner wurde nicht realisiert.


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache