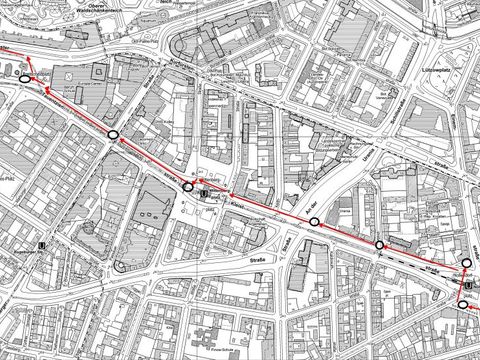Bundesallee 1-12 Ehemaliges Joachimsthalsches Gymnasium
Das klassizistische Gebäude im Stil der italienischen Hochrenaissance wurde 1875-80 von Ludwig Giersberg und Heinrich Strack für das bereits 1607 in Joachimsthal gegründete Gymnasium gebaut. Das Schulhaus in Joachimsthal wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Deshalb zog das Gymnasium bereits 1636 nach Berlin um, und zwar zunächst in das Berliner Stadtschloss und später an die Heiliggeiststraße. Heute befindet sich dort das Marx-Engels-Forum. Das Joachimsthalsche Gymnasium wurde zu einer der berühmtesten Elite-Schulen in Deutschland und erhielt 1707 von Friedrich I. den Titel “Königlich Joachimsthalsches Gymnasium” verliehen.
1880 zog es aus der Berliner Stadtmitte hierher in die Wilmersdorfer Vorstadtidylle auf ein riesiges Grundstück. Das Hauptgebäude gilt als spätes Beispiel der Schinkel-Schule.
Am Mittelrisalit stehen in zwei Nischen die Statuen von Plato und Aristoteles, die der Grunewalder Bildhauer Max Klein geschaffen hat. Zur Schule gehörte das gesamte Gelände hinter dem Hauptgebäude zwischen Schaperstraße und Meierottostraße bis zum Fasanenplatz mit Häusern für die Schüler und Lehrer, Sportplätzen, Turn- und Schwimmhallen usw.. Der zur Eröffnung des Gymnasiums anwesende Kaiser Wilhelm I. zeigte sich überrascht über die luxuriöse Ausstattung. Er stellte fest, dass die Bäder in seinem Schloss nicht so komfortabel waren wie hier.
Aber das Joachimsthalsche Gymnasium zog schon 1912 wieder aus. Es hatte sich wohl einerseits finanziell übernommen, aber andererseits war auch sehr schnell aus der Wilmersdorfer Vorstadtidylle die City West geworden, in der das Leben noch mehr tobte als in der Berliner Mitte.
Das Joachimsthalsche Gymnasium zog nach Templin in der Uckermark, wo es bis 1956 bestand. 2005 wurde die Schule in Joachimsthal neu gegründet.
In diesem Gebäude wurde bis 1919 das Joachim-Friedrich-Gymnasium untergebracht. Danach wurde es vom Bezirksamt Wilmersdorf als “Stadthaus” genutzt. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, 1955 wiederhergestellt, diente es in der Folge unterschiedlichen Zwecken, darunter als Stern’sches Konservatorium und Musikinstrumentenmuseum, heute befindet sich hier ein Teil des Fachbereichs Musik der Universität der Künste. Für die Musikhochschule wurde 1995 die Aula zum Konzertsaal umgebaut.
Eine Gedenktafel erinnert an Ehemalige Schüler:
“Wir gedenken unserer Kommilitonen
am Königlichen Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin
Generalleutnant Paul von Hase
Regierungspräsident a.D. Ernst von Harnack
Staatssekretär a.D. Erwin Planck
die in christlicher Verantwortung und humanistischer Tradition
Recht und Menschenwürde gegen die Tyrannei des NS-Staates verteidigten
und ihren Widerstand gegen Unrecht und Barbarei
vor fünfzig Jahren mit dem Leben bezahlten.
Ihr Opfer öffnete Deutschland den Weg in eine bessere Zukunft
und ist uns bleibende Verpflichtung.
Im April 1995 – Die Vereinigung Alter Joachimsthaler e.V.”
Nr. 216-218 Bundeshaus
Das Haus gegenüber wurde 1893-95 als Verwaltungsgebäude für die Königlich Preußische Artillerie-Prüfungs-Kommission an der früheren Kaiserallee errichtet von Bernhardt & Wieczorek. 1950-90 fungierte es unter der Bezeichnung Bundeshaus als Sitz des Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin. Bis zum Umzug des Ministerium des Inneren von Bonn nach Berlin befand sich hier außerdem eine Abteilung der Berliner Außenstelle des Ministeriums. Das Haus wird nach wie vor vom Innenministerium für diverse Bundeseinrichtungen genutzt, unter anderem für das Bundesverwaltungsamt.
1990 wurde links neben dem Eingang eine Berliner Gedenktafel für die Widerstandskämpfer Erich Hoepner und Henning von Tresckow enthüllt, 1996 rechts neben dem Eingang eine weitere Gedenktafel für das Bundeshaus und Konrad Adenauer.
Gedenktafel Hoepner/Tresckow:
“In diesem Gebäude, 1895 für die ehemalige Königlich-Preußische Artillerie- Prüfungskommission erbaut, arbeiteten während des 2.Weltkrieges die Offiziere des Widerstandes:
Generaloberst ERICH HOEPNER 14.9.1886 – 8.8.1944
Generalmajor HENNING VON TRESCKOW
10.1.1901 – 21.7.1944”
Gedenktafel Bundehaus:
“Dieses Gebäude wurde 1895 errichtet
Nach Beseitigung von Kriegsschäden hat es Bundeskanzler
Konrad Adenauer am 17. April 1950 als
BUNDESHAUS BERLIN
wieder eröffnet
Bis zur Wiedervereinigung 1990 war hier der Sitz
des Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin und der
Berliner Vertretungen von Bundesministerien”
Gefallenendenkmal
Das stelenartige, 4m hohe Denkmal für die Gefallenen des XXII. Reservekorps im I.Weltkrieg wurde 1924 von Eberhard Encke aus Muschelkalk geschaffen. Die abschließende Kugel trug ursprünglich eine Schwurhand.
Gerhart-Hauptmann-Anlage
Die kleine Gerhart-Hauptmann-Anlage auf dem ehemaligen weitläufigen Gelände des Joachimthalschen Gymnasiums wurde nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen Investoren, Parteien, den Berliner Festspielen und einer Bürgerinitiative um die Bebauung der Anlage wurden schließlich die Bebauungspläne aufgegeben.
1966 wurde das Gerhart-Hauptmann-Denkmal enthüllt, eine Granitstele mit einer Bronzebüste Hauptmanns von Fritz Klimsch.
Die Inschrift auf der Bodenplatte lautet: “Der deutschen Zwietracht mitten ins Herz”. In Hauptmanns Theaterstück “Florian Geyer” über den Bauernaufstand von 1525 beendet der Titelheld eine Rede an die Aufständischen mit diesem Satz. Wer den Satz bei Google eingibt, erlebt allerdings eine böse Überraschung, denn leider wird er von Rechtsextremisten missbraucht. Der ehemalige NPD-Vorsitzende Udo Voigt hat unter diesem Titel ein Buch über seine NPD-Karriere veröffentlicht. Gerhart Hauptmann kann sich leider nicht mehr dagegen wehren.
Bar jeder Vernunft
Auf dem Parkdeck ist die Rückseite der Bar jeder Vernunft zu sehen. Seit 1992 gibt es im Spiegelzelt jeden Abend Varieté, Kabarett, Chansons, Musicals und Konzerte. Sie ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine der schönsten und Bühnen der City West – immer wieder überraschend, anregend und auf hohem Niveau unterhaltsam.
Bundesallee 215: Shaolin-Tempel
2006 wurde der Shaolin-Tempel hier an der Bundesallee 215 eröffnet. Bereits im Juli 2001 war Deutschlands erster Shaolin-Tempel am Kurfürstendamm 102 eröffnet worden. Aus Platzgründen zog er im November 2004 in ein Fabrikgelände an der Franklinstraße um, schließlich 2006 hierher an die Bundesallee. Chinesische Mönche vermitteln zen-buddhistische Denk- und Lebensweise und unterrichten Kung-Fu, Tai Chi und Qi Gong. Der Begründer Reiner Deyhle wollte mit dem Tempel budhistische Kultur nach Berlin bringen. Er folgt den Lehren des Sharma, eines Nachfolgers Buddhas, der als Stifter des Chan- oder Zen-Buddhismus gilt, der chinesische Kultur und Buddhismus vereint.


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache