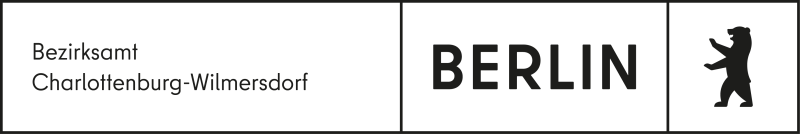HIER WOHNTE
GERTRUD KEIL
GEB. ROBERT
JG. 1902
DEPORTIERT 19.10.1942
RIGA
ERMORDET 22.10.1942
Gertrud Robert war die jüngste Tochter von dem am 12. Februar 1852 in Graudenz (Grudziadz im heutigen Polen) geborenen Hermann Robert und seiner Frau Natalie Koppel, die in Militsch (Milicz) in Niederschlesien am 27. März 1862 zur Welt gekommen war. Gertrud war am 6. September 1902 in Ulm geboren worden. Sie hatte zwei Schwestern und zwei Brüder, einer davon starb zweijährig an Diphtherie. Einige Zeit vor Gertruds Geburt, gegen 1890, zog die Familie von Graudenz nach Ulm, wo Hermann Robert ein Warenhaus betrieb, das unter dem Namen H. Tietz & Co, Inhaber Hermann Robert, firmierte. Um 1915 erlitt Hermann Robert einen schweren gesundheitlichen Einbruch und galt fortan als nicht mehr geschäftsfähig. 1916 wurde das Geschäft auf Natalie Robert umgeschrieben. Hermann Robert musste in eine psychiatrische Nervenklinik eingewiesen werden, damals Heil- und Pflegeanstalt genannt.
Wann und warum Gertrud nach Berlin kam, ist ungeklärt, vielleicht weil ihre älteren Geschwister Frieda und Georg bereits in der Hauptstadt lebten, vielleicht aber auch nach dem Tod der Mutter an einem Herzinfarkt 1934. Ein Jahr zuvor war Meta, die andere Schwester, an Darmkrebs gestorben. Nach der Heirat mit Max Keil lebte sie mit ihm in der Badenschen Straße und half mit in der Schuhmacherei. Eine Schwägerin Max Keils, vermutlich Frieda Robert, bediente in der Reparaturannahmestelle in der Kaiserallee. Am 6. August 1937 wurde die Tochter Ruth geboren.
Ein entscheidender und schrecklicher Einschnitt im Leben der Keils wurde die Pogromnacht vom 9./10. November 1938. Das Geschäft wurde geplündert und zerstört, auch in der Wohnung wurde geplündert, am 11. November wurde Max Keil festgenommen und in Sachsenhausen inhaftiert. Für Gertrud begann eine rastlose Zeit: sie musste für sich und die beiden Kinder eine neue, zunächst provisorische, Unterkunft besorgen, sich um das Schicksal ihres Mannes kümmern, Auswanderungspläne schmieden und vorantreiben. Max schrieb sie nach Sachsenhausen, Harry könne nach Holland gehen, eine neue Bleibe hätte sie in Aussicht. Max empfahl ihr, sich in der Auswanderungsangelegenheit vom Reichsbund der Frontsoldaten beraten zu lassen. Am 11. Januar 1939 wurde er entlassen. Er erhielt einen Teil seiner Maschinen zurück, konnte sie aber nicht mehr nutzen und stellte sie in der Pestalozzistraße 14 unter. Im Laufe des Jahres konnte die Familie dort eine Wohnung beziehen, denn 1940 ist Max Keil
unter dieser Adresse wieder im Adressbuch verzeichnet, Beruf Kaufmann.
Sich als Kaufmann durchzuschlagen war inzwischen für Juden fast unmöglich. Max Keil bezog noch seine Kriegsrente, aber auch diese dürfte, wie alle Renten von Juden, empfindlich gekürzt worden sein. Dazu kamen alle anderen antisemitischen Maßnahmen, die darauf abzielten, Juden völlig aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Dennoch setzten Max und Gertrud noch ein lebensbejahendes Zeichen: am 15. Januar 1940 bekamen sie eine zweite Tochter: Chana. Der Sohn aus erster Ehe, Harry, begann eine Bauschlosserlehre, wurde aber im April 1941, 16-jährig, zur Zwangsarbeit bei der Waffenfabrik Genschow, Bouchéstraße 12, herangezogen. Aus Holland war wohl nichts geworden. Mit anderen beteiligte er sich an Widerstandsaktionen und Sabotage, wurde erwischt und Anfang September 1941 für 3½ Monate im Arbeitserziehungslager Wuhlheide interniert. Auch Gertrud und sogar Max, obwohl er auf Krücken lief, mussten Zwangsarbeit leisten.
Wir wissen nicht, ob und wann Gertrud Nachricht vom jämmerlichen Tode ihres Vaters erhielt. 1940 befand sich Hermann Robert in der – ursprünglich fortschrittlichen – psychiatrischen Anstalt Günzburg. Dort hatte man aber schon 1938 zusammen mit der I.G. Farben „Humanexperimente“ durchgeführt, 1939 beteiligte sich die Anstalt an dem NS-„Euthanasie“-Programm zur Tötung psychisch Kranker indem Patienten in Tötungsanstalten weiterverlegt wurden. Am 5. Juli 1940 wurde Hermann Robert von Günzburg in die „Heil- und Pflegeanstalt“ Zwiefalten überführt, wo zur Tötung bestimmte Kranke vor allem aus Baden-Württemberg konzentriert wurden. Die Anstalt war folglich hoffnungslos überfüllt. Von hier wurden die Kranken, so auch Hermann Robert, in das nahe gelegene Grafeneck „verlegt“, wo sie in Gaskammern umgebracht wurden. Hermann Robert wurde noch 1940 ermordet.
Am 16. Oktober 1942 wurden Max, Gertrud, Ruth, Chana und auch Harry von der Gestapo abgeholt und in die als Sammellager missbrauchte Synagoge in der Levetzowstraße 7-8 gebracht. Harrys Mutter Herta, die inzwischen wieder aus dem Judentum ausgetreten war, gelang es, ihren Sohn nach drei Tagen – in letzter Minute – wieder frei zu bekommen. An diesem Tag, dem 19. Oktober 1942, wurden Max und Gertrud mit ihren fünf und zwei Jahre alten Töchtern Ruth und Chana zusammen mit 955 anderen Opfern – darunter 140 Kinder – vom Güterbahnhof Moabit aus nach Riga deportiert und dort drei Tage später in den umliegenden Wäldern ermordet.
Von Max Keils Brüdern überlebte keiner. Seine Schwägerin Minna geb. Horn, Jg. 1890, und Ehefrau und vermutlich Witwe von Benno Keil, wurde bereits am 19. Januar 1942 nach Riga deportiert. Markus Keil, geboren 1873, und sein 40–jähriger Sohn Bruno wurden bei der „Fabrikaktion“ von der (Zwangs-)Arbeit weg verhaftet und am 1. März 1943 nach Auschwitz deportiert. Auch der ein Jahr jüngere Sohn Herbert wurde im Rahmen der „Fabrikaktion“ am 12. März 1943 nach Auschwitz verschleppt. Markus’ Frau, 1876 als Johanna Holz geboren, wurde wenige Tage darauf, am 17. März 1943, nach Theresienstadt deportiert. Hermann Keil und seine Frau Paula geb. Gottfeld, Jg. 1891 und 1890, waren schon vorher, am 29. Januar 1943, nach Auschwitz deportiert worden. Der 28-jährige Sohn von Benno und Minna, Martin, und dessen fast gleichaltrige Frau Pepi, geb. Lecker, wurden bei der „Fabrikaktion“ verhaftet und am 4. März 1943 nach Auschwitz verschleppt. Von ihnen allen überlebte
lediglich Martin die Deportation. Sein Bruder Heinz und sein Vetter Hans, Sohn von Hermann Keil, entkamen rechtzeitig den Nazischergen. Max Keils Schwester Grete und ihr Mann Franz Hinzer waren schon früh in Gnesen gestorben, die andere Schwester, Martha Keil, verheiratete Marienfeld, starb 1939 in Berlin. Ihr Sohn Leo emigrierte wahrscheinlich schon in den 1920er Jahren in die USA.
Auch Gertruds 14 Jahre ältere Schwester Frieda Robert wurde am 26. September 1942 deportiert und bei Raasiku in Estland ermordet. Für sie liegt ein Stolperstein in der Livländischen Straße 17. Gertruds Bruder Georg erscheint glücklicherweise auf keiner Deportationsliste.
Harry Keil, Max Keils Sohn, nach dem Arbeitslager wieder Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie, wurde auch am 27. Februar 1943 am Arbeitsplatz verhaftet und in der Rosenstraße 2-4 inhaftiert. Obwohl er als „Geltungsjude“ wie ein „Volljude“ behandelt wurde (weil er jüdisch getauft und eingesegnet war), gelang es seiner „arischen“ Mutter ein zweites Mal, ihn aus der Gestapohaft frei zu bekommen. „Es wurden ihm keine Lebensmittelkarten ausgefolgt“ steht auf dem Entlassungsschein. Harry hatte weiter als „jugendlicher Hilfsarbeiter“ für 0,60 RM die Stunde 12 Stunden am Tag bei verschiedenen Firmen zu schuften – bis zum 9. Februar 1945. An diesem Tag war er ohne Judenstern unterwegs, wurde abermals festgenommen und nun in dem Lager Schulstraße 78 inhaftiert, das letzte Berliner Sammellager bis zum Kriegsende. Auch dieses überlebte er. 1948 heiratete er und starb in Berlin im Jahr 1989.
Recherchen und Text: Micaela Haas. Quellen: Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache