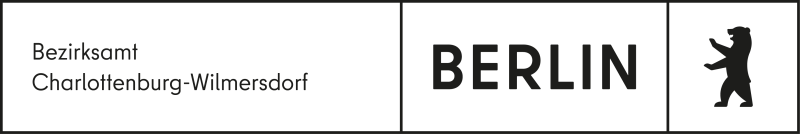Dodo war von klein auf sehr intelligent, aber es brauchte sehr viel Überzeugungskraft, damit sie auf ein Gymnasium gehen durfte. Von 1912 bis 1921 besuchte sie die Auguste-Victoria-Schule, danach bis 1925 die Fürstin-Bismarck-Schule – beide in Charlottenburg. Ihr Abitur absolvierte sie mit sehr guten Noten und schrieb sich an der Berliner Universität als Studentin der Physik ein. Sie war die erste Akademikerin in ihrer Familie. Sie wechselte an die Universität Heidelberg, musste aber nach einem Semester wieder nachhause kommen, da ihr Vater 1926 unerwartet starb. Es war für sie eine prägende Zeit, da sie bei vielen Professoren und Tutoren lernte, die namhaft in den Bereichen Relativitätstheorie und Unschärferelation waren.
Dodo und ihre Familie durchlebten schwierige Zeiten in Deutschland. Während des Ersten Weltkrieges war sie ein Kind und erinnerte sich daran, dass sie für ihren Onkel, der Soldat war, Socken strickte. Kurz nach Kriegsende litt Deutschland unter der großen Inflation, durch die die Familie nicht nur ihr Geld verlor, sondern auch allen Schmuck verkaufen musste. Sie mussten in eine preiswertere Wohnung umziehen, was zu Problemen zwischen Dodo und ihrer Mutter führte, sodass sie 1930 in ein möbliertes Zimmer zog.
Wegen der schwierigen finanziellen Lage musste Dodo neben dem Studium Geld verdienen. Zunächst gab sie Schulkindern Nachhilfe, dann arbeitete sie im Forschungslabor bei Osram. Sie musste sich daher sehr anstrengen, um ihr Studium zu beenden. Aber es gelang und sie forschte weiter bei Osram für ihre Promotion. Ihr späterer Ehemann Gerhard Liebmann (Gert) arbeitete zufällig als Werkstudent in derselben Abteilung. Sie waren sich schon im Alter von 20 Jahren an der Universität begegnet, heirateten aber erst 1936 als sie 29 Jahre alt waren.
1931 verließ Dodo Osram „auf Anraten“ wegen Problemen mit ihrem Chef und war einige Monate arbeitslos. Gert hatte inzwischen seinen Abschluss gemacht und arbeitete in der Radiofabrik Loewe. Dort konnte er sie in einen Assistentenposten vermitteln – ihre Beziehung mussten sie natürlich geheim halten. Abends arbeitete Dodo an ihrer Dissertation. Im November 1933 wurde ihr gekündigt, weil sie eine unbezahlte Auszeit genommen hatte, um ihre Doktorarbeit zu beenden. Sie befürchtete nämlich, nach der Machtübergabe an Hitler im Januar 1933 nicht mehr zur Promotion zugelassen zu werden, wenn sie die Abgabe der Arbeit noch länger hinauszögerte. Gert hingegen konnte weiter bei Loewe arbeiten, da einer der Direktoren jüdisch war und nicht alle jüdischen Angestellten hinausgeworfen wurden – wie es in vielen anderen Unternehmen der Fall war.
Bereits seit 1931 hatte Dodo sich politisch engagiert und trat 1933 in die Kommunistische Partei ein. Sie sah diese Partei als einzige Gruppierung an, die Untergrundaktivitäten organisierte, ohne Juden zu diskriminieren. Sie verteilte verbotene Schriften und traf sich mit anderen Mitgliedern der Gruppe. Bei mehreren Gelegenheiten gelang es ihr, beim Eintreffen der Gestapo Untergrund-Papiere zu verbrennen oder in der Toilette zu versenken. Um in dieser gefährlichen Lebenslage bei Verstand zu bleiben, verbrachten Dodo und Gert Wochenenden auf ihrem kleinen Segelboot auf einem der Seen im Grunewald.
Im Februar 1934 absolvierte Dodo schließlich ihr Doktorexamen. Neben der Doktorarbeit hatte sie vier mündliche Prüfungen zu bestehen – theoretische und experimentelle Physik, Mathematik und Philosophie. Sie musste für jedes Fach Professoren finden, die bereit waren, sie zu prüfen. Das war kein einfaches Unterfangen, denn etliche waren antisemitisch eingestellt und manche zudem frauenfeindlich.
Nach der erfolgreichen Promotion fand Dodo eine Beschäftigung als ungelernte Arbeiterin in der Radio-Industrie, wurde aber Ende 1934 erneut arbeitslos. So gab sie als Selbständige das Monatsjournal „Fortschritte der Funktechnik“ heraus, dass sie erfolgreich an europäische Universitäten und Museen verkaufte. Sie sollte eine Stelle in der Technischen Universität Berlin bekommen, um diese Arbeit von dort aus fortzusetzen. Die Zusage wurde aber zurückgezogen, weil sie Jüdin war. Bald darauf stellte sie die Herausgabe der Zeitschrift ein, um nicht unter Verdacht zu geraten. Sie beschrieb dies als ihre schlimmste antisemitische Erfahrung. Solange sie noch in Deutschland war, gab sie Unterricht und machte Studien- und Prüfungstrainings sowie Literaturrecherchen für Wissenschaftler.
Dodo und Gert heirateten 1936 – ein Teil ihres Fluchtplans. Wenn Gert eine Anstellung im Ausland fände, könnte Dodo nachkommen. Mit Hilfe von Freunden in London, die seine Bewerbung betrieben und das positive Resultat in einem kodierten Brief mitteilten, gelang das und Gert reiste innerhalb von Tagen über Paris nach London. Dodo packte binnen 36 Stunden ihr ganzes Leben ein und folgte ihm. Zunächst lebten sie bei den Freunden in London, zogen dann nach Cambridge, wo Gert im Januar 1937 seine Stelle bei der Firma Pey antrat.
In dieser Zeit beherbergte Dodo Besucher und Flüchtlinge auf der Durchreise, die versuchten Kontakte in England zu knüpfen. Im August 1937 wählte ihre Schwester Ilse, verheiratete Lichtwitz, den Freitod (Stolpersteine Kantstraße 30), Ihre Mutter Emmy im Januar 1939 ebenfalls – wie es damals so viele von den Nazis verfolgte Menschen taten. Dodo konnte natürlich nicht zu den Beerdigungen fahren. Es gelang Gert und Dodo aber, Gerts Eltern aus Deutschland nach England zu holen und ganz in ihrer Nähe eine Wohnung für sie zu finden. Dodo engagierte sich im Woburn House bei der Rettung von Kindern und Jugendlichen aus Deutschland mittels Kindertransporten.
Nach Kriegsausbruch wechselten Dodo und Gert ihre tägliche Umgangssprache von deutsch zu englisch. Sie konnten die deutsche Sprache einfach nicht mehr ertragen. Beide wurden 1939/1940 für neun Monate als „enemy aliens“ in unterschiedlichen Lagern auf der Isle of Man interniert – für Frauen eine eher ungewöhnliche Maßnahme. Dodo half in ihrem Lager, Entlassungsanträge auf den Weg zu bringen. Nach der Entlassung nahm Gert seine Arbeit bei Pye wieder auf. Dodo hätte auch gerne gearbeitet, erhielt aber nicht die dafür notwendige Erlaubnis.
1942 bzw.1945 wurden ihre beiden Kinder Marian und Stephen geboren. Unmittelbar nach Kriegsende beantragten Dodo und Gert die britische Staatsbürgerschaft, die ihnen 1946 gewährt wurde. Finanzielle Mittel waren immer knapp, zumal sie neben ihrer eigenen wachsenden Familie auch noch Gerts Eltern unterstützten.
In Deutschland hatten Gert und Dodo an Widerständen für Radios gearbeitet und ein Verfahren für die Herstellung von hochstabilen Carbon-Widerständen entwickelt und nach England mitgebracht. Das wollten sie einem bereits existierenden Unternehmen verkaufen, aber niemand glaubte, dass dies Verfahren funktionierte. So gründeten sie 1946 ihr eigenes Unternehmen – die Cambridge Electrical Components Ltd. (CELCO). Zunächst arbeiteten beide in ihrer eigenen Firma, aber nach der Kündigung von Pye 1947 nahm Gert einen neuen, besser zu ihm passenden Posten fern von Cambridge an. Dodo führte also das Unternehmen alleine weiter und konnte es – nachdem bewiesen war, dass das Verfahren funktionierte – 1949 an eine größere Firma verkaufen. Sie wurde für die nächsten drei Jahre als Consultant verpflichtet mit einem Honorar, das einen großen Unterschied für die Familienfinanzen machte.
Gert war also in Aldermaston, konnte nur jedes dritte Wochenende zu seiner Familie kommen und überließ Dodo die Erziehung und Versorgung der Kinder, die Führung des Unternehmens und die Unterstützung seiner alternden Eltern. Erst nach zweieinhalb Jahren, als Dodo die CELCO verkauft hatte, konnten sie mit den Kindern 1950 nach Aldermaston ziehen, sodass die Familie wieder vereint war. Das Leben in Aldermaston war einerseits angenehm, anderseits aber sehr isoliert. Die Familie wohnte in einer früheren schlecht isolierten Armeehütte und die Kinder mussten zehn Meilen zu ihrer Schule in Newbury fahren. Dodo verbrachte viel Zeit damit, alle zur nächsten Busstation zu fahren. Die Hausarbeit war ihr nicht genug – sie langweilte sich.
So suchten sie in der nächstgrößeren Stadt – Reading – ein Haus. Als ihnen keines zusagte, kauften sie ein Stück Land und eine Handvoll Architekturbücher, entwarfen ihr neues Heim selbst und überwachten den Baufortschritt. Es hatte vier Schlafzimmer – drei davon nach Süden – viele Bücherregale in den Kinderzimmern, eine Veranda, die groß genug für Tisch und Stühle war, ein kleines Arbeitszimmer für Gert, eine Garage, drei Nebengebäude und einen großen Garten. Dort erhielten sie einen großen Teil der alten Bäume des früheren Waldlandes. Dieses Vorhaben begann 1953 und im Dezember 1954 konnten sie einziehen.
Da die Kinder nun größer waren, wollte Dodo wieder im experimentellen Bereich arbeiten, aber auch Psychologie studieren. Sie schrieb sich also in der Universität Reading ein und hatte das erste Jahr fast beendet, als sie krank wurde und pausieren musste. Dann starb Gert ganz unerwartet 1956 an einem Herzschlag. Dodo musste also ihr Studium aufgeben und schnellstens eine Anstellung finden. Sie wurde am Reading Technical College als Mathematikdozentin eingestellt und arbeitete dort bis zu ihrer Pensionierung 1968.


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache