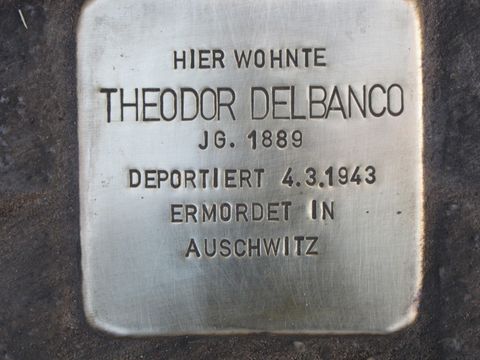Diese Stolpersteine wurden am 27.11.2012 verlegt.
Stolpersteine Hektorstraße 5
Stolpersteine-Initiative Charlottenburg-Wilmersdorf
Wegen der Wartezeit von 3 bis 4 Jahren können keine neuen Anträge für Stolpersteine angenommen werden. Bereits registrierte Anträge werden bearbeitet.
Because of a waitingtime of 3 to 4 years new requests for Stolpersteine cannot be accepted. Requests already registered will be processed.


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache