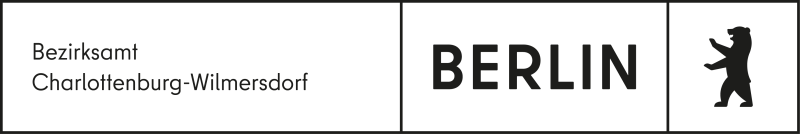Diese Stolpersteine wurden am 20.5.2014 verlegt. Spender waren Anna Bogunovic, Barica Divjakinja, Prof. Dr. Hartmut Espe, Familie Michael Hartwig, Familie Dr. Robert Heimbach, Familie Sebastian Loscher, Margit J. Mayer, Dr. Saaid Osman, Ralf Thielemann, Familie Norbert Wollschläger (alle Berlin) und Prof. Dr. Lothar Zeidler (USA).
„Eine feine Straße ist das hier. Sehr feine Gegend!“ Mit diesen Worten begann Norbert Wollschläger seine Ansprache vor mehr als 80 Menschen, die am Gedenken für die einstigen Hausbewohner teilnahmen. Unter ihnen waren Nachkommen zweier Opfer, Patricia Sedlatzek-Schneider, Ronald Sedlatzek, Olaf Feig (Frankfurt a.M.) und Prof. Dr. Lothar Zeidler (USA). Begrüßt wurden auch der Bürgermeister des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann, und der Vorsitzende des Jüdischen Bildungszentrums Chabad Lubawitsch Berlin, Rabbiner Yehuda Teichtal.
bq. ,Eine feine Straße ist das hier. Sehr feine Gegend!‘ So oder so ähnlich mochte Kurt Tucholsky – Journalist, Schriftsteller und Gesellschaftskritiker – die Duisburger Straße damals charakterisiert haben. Er liebte Berlins Neuen Westen, die Gegend um den Kurfürstendamm.
Zwischen 1912 und 1929 wohnte Tucholsky in Wilmersdorf. An wechselnden Adressen: Nachodstraße 12, Kaiserallee 79 (heute Bundesallee) und – hier gleich nebenan – Duisburger Straße 16, zur Untermiete, für einige Monate.
‚Eine feine Straße.‘ Dabei wusste Tucholsky wahrscheinlich nur recht wenig
über die eher unscheinbare Duisburger Straße mit ihren 21 Häusern, alle fertig gestellt zwischen 1912 und dem Sommer 1914, gerade als der Erste Weltkrieg begann. Die Straße profitierte von der Nähe zum Kurfürstendamm und dem Olivaer Platz, damals einer der schönsten Plätze Berlins. In der Duisburger Straße mit ihren ungefähr 300 Haushalten wohnten Vertreter des gehobenen Bürgertums. Kaufleute, mittelständische Unternehmer, Privatiers sowie etliche bildende und darstellende Künstler.
Von Anfang an hatte die Straße viele jüdische Anwohner. Folgt man neueren Berechnungen, dann lebte Ende der zwanziger Jahre in jedem dritten Haushalthalt der Duisburger Straße mindestens ein Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Jüdische Nachbarn zu haben, mit ihnen in derselben Straße oder im selben Haus zusammenzuleben, war ein Stück Normalität.
Das aber sollte sich alsbald ändern.
Angriffe auf dieses Zusammenleben begannen lange vor der sogenannten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Bereits zum jüdischen Neujahrsfest im September 1931 kam es auf dem Kurfürstendamm und seinen Nebenstraße zu massiven antisemitischen Ausschreitungen.
Mit Ernennung Hitlers zum Reichskanzler geriet Antisemitismus zur Staatsräson und der Alltag der jüdischen Anwohner verschlechterte sich schlagartig. Mit den Nürnberger Ariergesetzen wurden sie zu Angehörigen einer minderwertigen Rasse erklärt und verloren ihre bürgerlichen Rechte.
Für die Wilmersdorfer Juden begann mit dem Novemberpogrom von 1938 eine schreckliche Zeit. Alle drei Synagogen des Bezirks wurden in Brand gesteckt. Unschuldige Menschen wurden in Konzentrationslager gebracht, Familien wurden auseinander gerissen, jüdischen Mietern wurden Wohnungen gekündigt, jüdische Hauseigentümer wurden enteignet, und die Gegend um den Kurfürstendamm zum ‚judenreinen Gebiet‘ erklärt, in das keine als jüdisch geltenden Mieter mehr einziehen sollten.
Mit Beginn des 2. Weltkrieges verschärften sich die Lebensbedingungen der ins Deutschland verbliebenen Juden noch einmal erheblich. Auch in der Duisburger Straße. Ab Februar 1941 werden gezielt Wohnungen jüdischer Bewohner geräumt, und ab Oktober 1941 beginnen systematische Zwangräumungen, Verschleppungen und Deportationen.
Der Berliner Historiker Dirk Nordhoff zieht eine grausame Bilanz:
‚Von den 236 als jüdisch definierten Anwohnern [der Duisburger Straße] brachten sich mindestens sieben um, vermutlich aus Angst vor der bevorstehenden Deportation. Mehrere Menschen starben unter unbekannten Umständen. 109 Menschen wurden deportiert und starben in Konzentrationslagern, die meisten wurden zwischen April und Oktober 1942 nach Theresienstadt oder im ersten Halbjahr 1943 nach Auschwitz gebracht. Einige Deportationsopfer wurden über die besetzten Nachbarländer Belgien, Frankreich und die Niederlande in Lager verschleppt, rund 90 wurden aber direkt von Berlin aus in den Tod geschickt.‘
Das jüngste Deportationsopfer war 4 Jahre alt, das älteste 88 Jahre.
Die Deportationen in der Duisburger Straße vollzogen sich nicht massenweise, sondern eher diskret: in Abständen mehrerer Tage oder Wochen, manchmal von Monaten, mal einen Juden, mal zwei oder auch vier jüdische Bewohner. Vielleicht auch um in dieser kleinen Straße zuviel Aufsehen zu vermeiden.
Wir wissen wenig von den Reaktionen der nichtjüdischen Nachbarn. Mit Sicherheit aber konnte das Verschwinden der Menschen nicht unbemerkt geblieben sein.
Karl Jaspers, Philosoph und Doktorvater von Hannah Arendt, hat sich früh und intensiv mit der Schuldfrage auseinandergesetzt.
‚Wir Überlebenden haben nicht den Tod gesucht. Wir sind nicht, als unsere jüdischen Freunde abgeführt wurden, auf die Straße gegangen, haben nicht geschrien, bis man uns vernichtete. Wir haben es vorgezogen am Leben zu bleiben mit dem schwachen, wenn auch richtigem Grund, unser Tod hätte nichts helfen können. Dass wir leben, ist unsere Schuld. Wir wissen vor Gott, was uns tief demütigt.‘
Uns, den Nachgeborenen – die wir nicht wissen, wie wir selbst gehandelt hätten – fehlt die moralische Kompetenz, zu richten. Aber es ist unsere fortdauernde Verpflichtung, der Opfer zu gedenken und ihnen einen Ort zu geben, an dem man sich immer wieder an sie erinnern kann. Ein Ort, der auch nie vergessen machen soll, aus welchem Land die Täter kamen.
Heute leben jüdische und nicht jüdische Bewohner im Haus Duisburger Straße 19 wieder zusammen. Ein Stück Normalität, wie es überall auf der Welt sein sollte. In jedem Land, in jeder Stadt, in jeder Straße, in jedem Haus.


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache