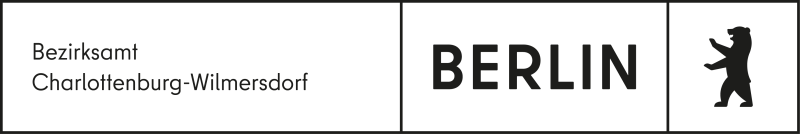HIER WOHNTE
DR. SIMON VOGEL
JG. 1866
DEPORTIERT 1944
THERESIENSTADT
ERMORDET 17.2.1945
Simon Hermann Vogel wurde am 29. März 1866 in Spenge in Westfalen geboren. Er war der Sohn von Jakob Vogel und dessen Ehefrau Adelheid geborene Berliner. Über das Elternhaus, die Kindheit und Jugend von Simon Vogel haben sich keine Informationen ergeben. Seine Eltern gehörten aber aller Wahrscheinlichkeit nach zur jüdischen Gemeinde der Stadt Spenge, die zur Synagogengemeinde Enger gehörte und in der es Anfang des 19. Jahrhunderts wie in anderen Gemeinden auch während der sogenannten „Hep-Hep-Unruhen“ zu antijüdischen Ausschreitungen gekommen war. Simon Vogel studierte nach seinem Schulabschluss Medizin, promovierte 1890 an der Universität Straßburg mit einer Arbeit zu einem Schlaf- und Narkosemittel mit dem Titel „Tertiäres Amyl-carbamid als Hypnoticum“ und erhielt 1891 seine Approbation. Um 1893 ließ sich der Mediziner in Berlin nieder – als Assistenzarzt in der gynäkologischen Frauenklinik von Professor Dr. Leopold Landau (1848–1929) in
der Philippstraße 21 in Mitte. 1896/1897 eröffnete Simon Vogel eine eigene Frauenklinik in der Kommandantenstraße 83. Um 1900 verlegte er die Privatpraxis an den Michaelkirchplatz 10 und 1910 in die Martin-Luther-Straße 27 in Schöneberg, bevor er in den 1910er-Jahren in die Berliner Straße 153 in Charlottenburg zog, wo er sich Privatwohnung und Praxis einrichtete.
Am 30. September 1913 heiratete er in Schöneberg die fünf Jahre jüngere Krankenschwester und Oberin Marie Klara Rutz, die aus dem damals ostpreußischen Drawöhnen (dem heutigen Dreverna) stammte. Ihre Eltern, der Fabrikbesitzer Ferdinand Rutz und seine Frau Marie, geborene Heiligenfeld, waren zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits verstorben. Bei der Hochzeit war der inzwischen in Berlin als Rentier lebende Vater von Simon, Jakob Vogel, als Trauzeuge zugegen. Seine Mutter war bereits 1903 verstorben. Simon und Marie Klara Vogel blieben kinderlos. 1917 wurde Simon Vogel der Titel eines Sanitätsrats verliehen. Leider haben sich keine weiteren Quellen erhalten, die einen Einblick in das Leben der Vogels im Berlin der ausgehenden Kaiserzeit und Weimarer Republik geben könnten.
Mit der schrittweisen Entrechtung und Verfolgung von Juden seit 1933 – beziehungsweise aller Personen, die nach den Nürnberger Gesetzen im NS-Staat als Juden galten – begannen auch Zwangsmaßnahmen gegen Simon Vogel. Darunter fielen zahlreiche Maßnahmen der Diskriminierung und sozialen Ausgrenzung, des Entzugs staatsbürgerlicher Rechte sowie der Verdrängung aus dem Berufs- und Wirtschaftsleben. So wurden „nichtarische“ Ärzte mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933“ vom öffentlichen Gesundheitswesen ausgeschlossen, zwischen 1933 und 1937 wurden ihnen sukzessive mit insgesamt sieben Verordnungen die Kassenzulassungen entzogen, mit der Verordnung vom 20. November 1933 durften sie keine ärztlichen Fortbildungskurse mehr besuchen und wurden vom ärztlichen Bereitschaftsdienst ausgeschlossen. Am 30. September 1938 wurde Simon Vogel wie allen jüdischen Ärzten und Ärztinnen mit der „Vierten Verordnung zum
Reichsbürgergesetz“ die Approbation entzogen. Zwischen 1939 und 1944 konnte er in Berlin noch als „Krankenbehandler für Frauenkrankheiten“ jüdische Patientinnen versorgen und richtete sich dazu Praxisräume in seiner Wohnung ein.
1942 hatte er seine langjährige Berliner Wohnung in Charlottenburg aufgeben müssen und war in die Nettelbeckstraße 26 (der heutigen An der Urania) gezogen. Da er nach NS-Terminologie in einer sogenannten privilegierten Mischehe mit seiner Ehefrau lebte, galten für den Arzt Ausnahmeregelungen, die ihn beispielsweise davor bewahrten, ab September 1941 in der Öffentlichkeit einen „Judenstern“ tragen zu müssen. Auf seine „arische“ Ehefrau wurde allerdings von den Behörden – und vermutlich auch der Gestapo – Druck ausgeübt, die Ehe zu beenden. Dazu kam es nicht. Als sie in den ersten Jahren der 1940er-Jahre verstarb, verlor Simon Vogel nicht nur seine Ehefrau, sondern auch den prekären Schutz durch sie. Der 78-Jährige wurde kurz nach ihrem Tod am 19. April 1944 mit dem 104. „Alterstransport“ in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Er überlebte die unmenschlichen Bedingungen im Ghetto fast ein Jahr, bevor er wenige Wochen vor Kriegsende, am 17. Februar 1945,
in Theresienstadt starb – entweder durch direkte Gewalteinwirkung oder indirekte mittels planvoller Mangelernährung, versagter Medikamente, Kälte und körperlichen Misshandlungen.
Biografische Zusammenstellung
Indra Hemmerling
Weitere Quellen
Holocaust Survivors and Victims Database. Online Database of the United States Holocaust Memorial Museum. Online unter: https://www.ushmm.org/online/hsv/p… (aufgerufen am 30. Juli 2019)
Eheanzeige Simon Vogel und Marie Klara Rutz (Nr. 580, Berlin-Schöneberg am 30. September 1913); Eheregister der Stadt Berlin 1874–1920. Faksimile online unter: ancestry.com (aufgerufen am 15. Oktober 2019)
Deportationslisten. Reproduktion im National Archives and Records Administration, USA, Signatur A3355: Helmuth Unger (104. „Alterstransport“, Lfd-Nr. 29). Online unter: statistik-des-holocaust.de (aufgerufen am 22. Oktober 2019)
Toten-Begleitschein Simon Vogel in der Opferdatenbank Theresienstadt. Online unter: holocaust.cz (aufgerufen am 22. Oktober 2019)
Totenschein für Simon Vogel. Sonderstandesamt Arolsen (Nr. 326, Arolsen, Zweitauszug ausgestellt am 14. April 1953). Faksimile online unter: ancestry.com (aufgerufen am 15. Oktober 2019)
Eintrag zu Leopold Landau. Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte. Online unter: http://www.zeno.org/Pagel-1901/A/L… (aufgerufen am 22. Oktober 2019)
Eintrag zu Simon Vogel, in: Schwoch, Rebecca (Hrsg.): Berliner jüdische Kassenärzte und ihr Schicksal im Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch, Potsdam 2009, S. 874
Eintrag zu Simon Vogel, in: Schwoch, Rebecca: Jüdische Ärzte als Krankenbehandler in Berlin zwischen 1938 und 1945, Frankfurt am Main 2018, S. 547–548


 DGS
DGS Leichte Sprache
Leichte Sprache