Postanschrift
12591 Berlin
Erde statt Himmel
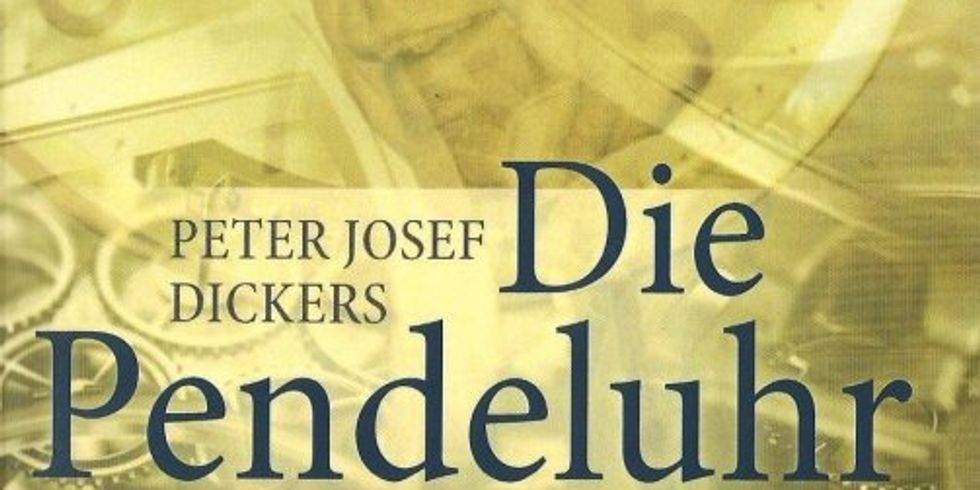
Bild: Verlag Books on Demand, Norderstedt
von Peter Josef Dickers
Hungerjahre prägten das Leben in unserem Dorf nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Von einem Wirtschaftswunder, von heiler Welt in der Nachkriegszeit war nichts zu spüren. Leute aus der Stadt unternahmen Hamsterfahrten zu uns ins Dorf, um Bauern und Privatleuten Tauschgeschäfte anzubieten. Die Reichsmark war wertlos. Kartoffeln gegen Kunstgegenstände, Milch und Butter gegen Schmuck.
Schwarzhandel hatte Hochkonjunktur. Güter des täglichen Bedarfs gegen handfestes Hab und Gut. Ob noch Krieg oder schon Friede war, ließ sich schwer unterscheiden. Eine Zeit, in der im zwischenmenschlichen Bereich jeder jedem den Krieg zu erklären schien, nachdem der Krieg mit Waffen ein Ende gefunden hatte.
Wenn ich bei dem Bauern, mit dem unsere Familie in verwandtschaftlicher Beziehung stand, um eine Kanne Milch, ein Stück Butter oder ein paar Kartoffeln bettelte, hatte ich Aussicht auf Erfolg, wenn ich im Tausch dafür Zigaretten anbot – eine Kostbarkeit, die wir von amerikanischen Soldaten ergatterten, die sich im Dorf einquartiert hatten.
Vergesst Gott nicht in eurer Not, hatte der Pfarrer die Gläubigen in der Kirche ermahnt. Meine Mutter war gläubig, aber sie musste eher nach irdischen Dingen als nach dem Himmel Ausschau halten. Irdische Realitäten standen näher als der Himmel. Himmel war weit weg. Es ging ums Überleben, um konkret Erreichbares.
Sie benötigte Lebensmittelkarten für Brot und Fleisch, Kleiderkarten für Unterwäsche und Strümpfe, Bezugsscheine für Mäntel und Schuhe. Für ein Bündel alter Zeitungen bot der Altpapierhändler ein paar Pfennige an.
Neue Schuhe, die ich zur Feier meiner Erstkommunion erhalten sollte, waren nicht erschwinglich. Ein Schuster stellte sie in Heimarbeit her. Den Kommunionanzug erbettelte Mutter. Anzug und Schuhe befanden sich als Erinnerungsstücke noch in meinem Kleiderschrank, als ich fünfzehn Jahre später umzog an meinen Studienort.
Sie waren nicht in der Kostümtruhe gelandet. Ich hatte sie nicht als Ladenhüter, sondern als Erinnerung an Geschehnisse aufbewahrt, die entrückt waren, mich aber, zumindest unbewusst, begleitet hatten.
Das Dorf war unser Leben. Das Dorf war unser Himmel. Die Welt hinter dem Gartenzaun war überschaubar. Bauernhöfe, grüne Wiesen. Kartoffeläcker. Keine Postkarten-Motive. Kleinbürger-Idyll rund um die alte, romanische Pfarrkirche. Hier fühlten wir uns sicher und geborgen. Hier erhofften und fanden wir Schutz.
Der Dorfpfarrer wusste, was gut und richtig war. Unser Wahrsager. Unsere moralische Instanz. Er hatte in gottesfürchtigen Landen Macht über Leben und Tod. Von der Kanzel herab verkündete er Wahrheiten, die als unverrückbar galten. Alltagsleben und Leben mit der Kirche waren miteinander verknüpft. Die Institution Kirche gewährte und garantierte Halt und Sicherheit. Die Kirche war den Menschen nah und diese der Kirche.
„Bleibe, wie du heute bist. Der Himmel dir dann sicher ist.“ Ein Plakat mit dieser Inschrift prangte über den Haustüren, wenn ein Kind zur Erstkommunion in die Kirche geleitet wurde. Auch über unserer Tür. Wer immer solche und ähnliche Sprüche ersonnen hatte – sie beschrieben eine Welt, von der jeder wusste, dass es sie so nicht gab, die aber dennoch insgeheim ersehnt wurde. Das Aufschauen zum Himmel glich einem Balance-Akt zwischen Himmel und Erde.
Kriegszeiten seien Zeiten großmütiger Nächstenliebe und gesteigerten Opferwillens; das stehe in den „Katechetischen Blättern“, hatte der Pfarrer gesagt. Jeder müsse mithelfen im Geist christlicher Bruderliebe. Hilfsbereitschaft und Mut zur Bescheidenheit seien das Gebot der Stunde. Gut, dass die Leute die Katechetischen Blätter nicht kannten. Verzichten mussten sie.
Satt werden war wichtig. An Überfluss litt niemand. Die Zeitung kündigte eine Kürzung der Lebensmittelrationen an. Eine Frau wurde beim Milchdiebstahl erwischt, als sie Milch von einer an der Straße abgestellten Kanne abzapfte. Obwohl sie aus Not handelte, wurde sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Ein Verwandter meiner Mutter bot ihr an, heimlich das gemästete Hausschwein zu schlachten, um die Fleischrationen für die nächsten Monate zu sichern. Viel falsch machen konnte sie nicht. Wie viel Fleisch er für sich selbst reservierte und welche sonstigen Dienste meiner Mutter er einforderte, blieb unausgesprochen.
Interessengegensätze. Sie klagte nicht – weder über ihr Leben, noch über das Leben anderer. Sie hätte Gründe gehabt. Aber wer hätte ihr zugehört? Sie nahm ihr Leben hin. Ihr blieb das Beten. Niemand weiß, ob es geholfen hat.
Friedvolle Idylle, Hort der Harmonie und Beglückung, der Ruhe und Stabilität war unser Heim nicht. Keine heile Welt. Keine heile Familie. Kein „dolce vita“. Keine Zeit für Müßiggang. Mutters Leben ließ ihr wenig Zeit für Träume. Die Familie, der sie vorstand, war nicht in süße Zuckerwatte gepackt. Von besseren Zeiten zu träumen, war zwecklos. Dennoch hätte sie nicht woanders leben wollen.
Kein Wunder, dass sie nicht sehr alt geworden ist. Im Alter von gut sechzig Jahren waren ihre Kräfte aufgezehrt. Ihr Lebensfaden war durch viele Zerreißproben brüchig geworden. Die „gute, alte Zeit“, ihre Zeit, in der angeblich alles besser war, konnte so besonders gut nicht gewesen sein. Es herrschten keine paradiesischen Zustände.
Und doch habe ich Mutter nie verbittert, nie griesgrämig erlebt. Sie sang gern – vielleicht, um die Schatten der Vergangenheit und Gegenwart für eine Weile beiseite zu schieben. Ein Lied zu singen, mochte befreiend wirken. Das Bild, das sich mir von ihr eingeprägt hat, begleitet mich bewusst oder unbewusst immer noch. Es gehört zu meinen nicht erloschenen Kindheitserinnerungen.
Beendet wurden die bedrängenden Zeitumstände vorerst durch die Währungsreform. Die Deutsche Mark wurde zum alleinigen Bezugsschein für Waren. Im einzigen Geschäft des Dorfes tauchte über Nacht das zu hohen Preisen in den Regalen auf, was anscheinend tags zuvor noch nicht existiert hatte.
Rosige Märchenbilder sind nicht die Bilder jener Jahre, die in mir haften geblieben sind. Wenn ich eintauche in den Horizont meiner Kindheit, kommen verklärte Erinnerungen an Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe kaum zum Vorschein. Meine Gedanken wandern hinüber ins Pfarrarchiv meiner Heimatgemeinde. Es sollen dort Niederschriften fehlen über die Jahre zwischen 1931 und 1949, vornehmlich über die Jahre des Nationalsozialismus.
Manche Eintragungen wurden, so wird unterstellt, nachträglich gelöscht, als habe es sie nie gegeben. Es müssen Erinnerungen gewesen sein, die man verdrängte oder tilgen wollte. Eine Selbsttäuschung. Die so handelten, bekleideten möglicherweise verantwortliche Positionen in der Schule, in der Pfarrei, in der Gemeinde.
„Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg.“ Das Volkslied aus der Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ haben wir nicht gesungen, sondern erlebt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass mein Vater irgendwo im Schützengraben voll Sehnsucht an die Liebste daheim „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein“ vor sich hin trällerte, das von den Nationalsozialisten zu Propaganda-Zwecken missbrauchte Lied.
Falsche romantische Gefühle, die eine heile Welt vorgaukelten, waren ihm und meiner Mutter zuwider. 1942 fiel mein Vater in Russland. Ein Aufruf des Führers zum „Kriegswinterhilfswerk des Deutschen Volkes“ forderte das Volk in der Heimat zu höchster Opferbereitschaft auf. Opfer, die wir leisten könnten, seien nur ein Bruchteil dessen, was die deutsche Wehrmacht verbringe, tönte er. Er erwarte, dass die Heimat ihre Pflicht erfülle. Der Appell muss wie Hohn in den Ohren meiner Mutter geklungen haben.
SeniorenServiceBüro
Sozialkommission
- Tel.: (030) 90293 4371
- Fax: (030) 90293 4355
- E-Mail SeniorenServiceBuero@ba-mh.berlin.de
Sonder-Sozialkommission
Redaktion Spätlese
Leiter: Herr Kolbe

